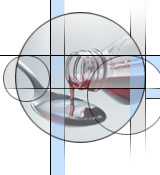

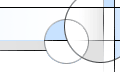


Der Predigttext für den 6. Sonntag nach Trinitatis ( 29.6.) steht im 1. Petrusbrief, Kapitel 2, die Verse 2 – 10
Seid begierig nach der vernünftigen lauteren Milch wie die neugeborenen Kindlein, damit ihr durch sie zunehmt zu eurem Heil, da ihr ja geschmeckt habt, dass der Herr freundlich ist. Zu ihm kommt als zu dem lebendigen Stein, der von den Menschen verworfen ist, aber bei Gott auserwählt und kostbar. Und auch ihr als lebendige Steine erbaut euch zum geistlichen Hause und zur heiligen Priesterschaft, zu opfern geistliche Opfer, die Gott wohlgefällig sind durch Jesus Christus.
Darum steht in der Schrift (Jesaja 28, 16) „Siehe, ich lege in Zion einen auserwählten, kostbaren Eckstein; und wer an ihn glaubt, der soll nicht zuschanden werden. Für euch nun, die ihr glaubt, ist er kostbar; für die Ungläubigen aber ist „der Stein, den die Bauleute verworfen haben und der zum Eckstein geworden ist, ein Stein des Anstoßes und ein Fels des Ärgernisses“ (Psalm 118, 22; Jesaja 8, 14); sie stoßen sich an ihm, weil sie nicht an das Wort glauben, wozu sie auch bestimmt sind.
Ihr aber seid das auserwählte Geschlecht, die königliche Priesterschaft, das heilige Volk, das Volk des Eigentums, dass ihr verkündigen sollt die Wohltaten dessen, der euch berufen hat von der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht; ihr die einst „nicht ein Volk“ wart, nun aber „Gottes Volk“ seid, und einst nicht in Gnaden wart, nun aber in Gnaden seid (Hosea 2, 25).
Die Taufe ist das Thema dieses Sonntages. Der Predigttext öffnet sich nicht sofort diesem Thema.
Zuerst einige Hinweise auf den ersten Petrusbrief. Die Verfasserschaft des Petrus für den ersten wie den zweiten Brief ist umstritten. Entscheidend für diese Annahme dürfte sein, dass im ersten Petrusbrief keine wichtigen Erkenntnisse aus der tatsächlichen Zeugenschaft des Petrus finden.
Anfang und Ende des Briefes haben die typischen Merkmale eines antiken Briefes. Dem Inhalt des Briefes fehlt eine deutliche Disposition, wobei aber die Absichten und das Thema der verschiedenen Briefteile deutlich sind.
Das Leben der Christen wird durch die Auferstehung deutlich verändert. Die Auferstehung gibt eine begründete Hoffnung auf das sichere Heil bei Gott.
Der Predigttext für den Trinitatissonntag (18. Mai) steht im 2. Brief des Paulus an die Korinther, Kapitel 13, die Verse 11 – 13
Zuletzt, liebe Brüder, freut euch, lasst euch zurechtbringen, lasst euch mahnen, habt einerlei Sinn, haltet Frieden! So wird der Gott der Liebe und des Friedens mit euch sein. Grüßt euch untereinander mit dem heiligen Kuss. Es grüßen euch alle Heiligen.
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen.
Dieser Sonntag trägt den lateinischen Namen Trinitatis oder zu deutsch „Tag der Heiligen Dreifaltigkeit“. An diesem Sonntag wird also ein bestimmtes Thema des christlichen Glaubens zur Sprache gebracht.
Die Entstehung dieses Sonntages ist im Zusammenhang mit einer theologischen Auseinandersetzung geschehen, die im dritten und vierten nachchristlichen Jahrhundert die noch junge Kirche in eine große Krise stürzte. Sie ist verbunden mit der Person des Arius (280 – 336), der mit seiner Überzeugung besonders im germanischen Kulturraum viele Anhänger fand. Arius vertrat die Überzeugung, dass Christus Gott nicht gleichgestellt und mit ihm wesenseins, sondern von Gott geschaffen und damit ihm untergeordnet sei. Die mit dieser Überzeugung verbundenen Fragen und Auseinadersetzungen wurden nicht nur im Kreis der Theologen, sondern auch in der christlichen Bevölkerung der damaligen Zeit heftig diskutiert.
Die Menschen beteten bis zu der arianischen Auseinandersetzung vor allem zu Gott, dem Vater durch Christus im Heiligen Geist. Am Ende des theologischen Diskurses stand die einhellige Überzeugung in der gesamten Kirche, dass die drei göttlichen Personen Vater, Sohn und Hl. Geist einander gleich geordnet und unabhängig voneinander angebetet werden können. Die Lehre von der Dreieinigkeit Gottes war von da an zentrales Dogma des christlichen Glaubens. Die heutige Stellung im Sonntagskalender des Kirchenjahres gibt die Möglichkeit, die zentralen christlichen Feste – Weihnachten , Ostern und Pfingsten – abschließend inhaltlich zusammenzufassen.
Der Predigttext dieses Sonntages sind die abschließenden Verse des 2. Korintherbriefes.
Der letzte Vers, der Vers 13, ist Gottesdienstbesuchern auch als Kanzelgruß bekannt, dem Text mit dem die Gemeinde vor der Verlesung des Predigttextes und der Predigt gegrüßt wird.
Die Gemeinde in Korinth ist von Paulus während eines 1 1/2jährigen Aufenthaltes zwischen 49 und 52 nach Christus gegründet worden. (siehe Apostelgeschichte 18, 1 -8) Sie setzt sich aus ehemaligen Juden, „Gottesfürchtigen“ = nichtjüdische Angehörige anderer Volksgruppen, die sich aus religiösen Gründen der jüdischen Gemeinde verbunden fühlten und „Heiden“, also Anhängern anderer religiöser Gruppen und Überzeugungen zusammen.
Nach 1. Korinther 12, 2 dürften „Heiden“ die Mehrheit dieser Gemeinde gestellt haben.
Die soziale Gliederung ist an mehreren Stellen des 1. Korintherbriefes (z.B. 1, 26 – 28) erkennbar. Es sind dort Angehörige der Oberschicht, Handwerker, Lohnarbeiter und Sklaven anzutreffen. Die zahlenmäßige Größe der Gemeinde dürfte so klein gewesen sein, dass sie sich als Hausgemeinde versammeln konnte.
Innerhalb des zweiten Korintherbriefes verdienen die Kapitel 10 – 13 eine besondere Beachtung. Hier ist die Auseinandersetzung mit den „Gegnern“ des Paulus der inhaltliche Schwerpunkt des Textes. Schon im 1. Korintherbrief ist von verschiedenen Gruppen die Rede, die sich an einzelnen Missionarspersönlichkeiten und deren Theologie orientieren:
„Denn wenn der eine sagt: ich gehöre zu Paulus, der andere aber: Ich zu Apollos -, ist das nicht nach Menschenweise geredet?“ Paulus muss sich gegen Kritik und die Infragestellung seiner apostolischen Autorität zur Wehr setzen.
In den letzten vier Kapiteln des zweiten Korintherbriefes ist zu erkennen, dass eine judenchristliche Missionsgruppe Einfluss auf einen Teil der korinthischen Gemeinde gewonnen hat. Die Spannungen zwischen Judenchristen und Heidenchristen und die damit verbundenen theologischen Klärungen sind ein zentrales Thema der neutestamentlichen Schriften von der Apostelgeschichte bis in die Briefe des Paulus.
Hauptvertreter der judenchristlichen Theologie sind Jakobus, der Bruder Jesu und Gemeindeleiter der christlichen Gemeinde in Jerusalem. Sein Gegenüber ist Paulus.
Petrus vertritt eine unterschiedliche Position. Paulus wirft ihm im Galaterbrief, Kapitel 2, in den Versen 11- 17 eine „heuchlerische“ Haltung vor. Dieser so genannte „antiochenische Zwischenfall“ scheint auch der Hintergrund für die Spannungen in Korinth zu sein.
Was ist der eigentliche Grund der Auseinandersetzung?
Genau so wie die Apostel, die zwölf Jünger als Augen- und Ohrenzeugen der Lebenszeit Jesu, verkündigte Paulus die frohe Botschaft, das Evangelium von dem Kreuzestod Jesu als Sühnetod, die Grablegung und die Auferweckung am dritten Tage. Das von Jesus kommende Abendmahlsverständnis gibt Paulus an die von ihm durch seine Missionstätigkeit entstandenen Gemeinden weiter. In diesen Gemeinden trittt er für einen Lebenswandel ein, der dem Willen Gottes entspricht und ein Beispiel für eine nichtchristliche Umwelt sein soll.
Die judenchristlichen Gegner des Paulus – also auch die ehemaligen Jünger Jesu – macht die „gesetzeskritische“ Predigt des Paulus argwöhnisch. Der wichtigste Satz, der sich durch alle Äußerungen des Paulus hindurchzieht, steht im Römerbrief, Kapitel 3, Vers 28 „Wir sind der Meinung, dass ein Mensch (allein) aus Glauben ohne Werke des Gesetzes von Gott gerechtfertigt wird.“
Die Jünger Jesu waren von ihrem religiösen Ursprung her Juden, so wie Jesus es auch war. Nach jüdischem Verständnis war den Menschen der Wille Gottes in Form von Geboten und Verboten (Urform = 10 Gebote) durch Mose gegeben worden. Wichtigste Gebote waren das Sabbatgebot und Reinheitsgebote. Der siebte Tag der Woche gehörte Gott. Alle Handlungen des Menschen sollten an diesem Tag darauf gerichtet sein, an Gott zu denken und ihm die Ehre zu geben. Mit dem Sabbattag als Gottestag sollte sichtbar werden, wer der eigentliche „Herr“ der jüdischen Menschen und des jüdischen Volkes ist. Mit den „Reinheitsgeboten“
verbanden sich Vorschriften zu „reinen“ und „unreinen“ Speisen und religiös richtigen und unrichtigen Lebensweisen. Diese jüdischen Reinheitsvorschriften betrafen also den alltäglichen frommen Lebenswandel.
Mit der Übernahme des christlichen Glaubens entstand für die ersten Christen – besonders die Jünger und Gemeindeglieder in Jerusalem – die Frage, inwieweit die bisher jüdischen religiösen Regeln weiter galten oder nicht. Die „gesetzeskritische“ Predigt des Paulus schien die in der Anfangszeit geübte Praxis einer aus jüdischer und christlicher Theologie vermischen Theologie in frage zu stellen. Anders gesagt: Wollte die erste christliche Gemeinde eine Sonderform jüdischen Glaubens oder eine selbständige religiöse Gruppe mit einer eigenen Theologie sein? Diesen Prozess der Verselbständigung und Einzigartigkeit des christlichen Glaubens und der daraus entstehenden christlichen Kirchen spiegelt sich in der Auseinandersetzung des Paulus mit seinen christlichen Gegnern. Es ist eine hoch dramatische und spannende geistliche und geistvolle Auseinandersetzung, an der die Leser der Schriften des Neuen Testamentes bis heute beteiligt werden.
Für Paulus gilt, dass „Christus uns freigekauft hat vom Fluch des Gesetzes“. (Galaterbrief, 3, 13) Es ist für ihn Gottes Werk, dass durch den Sühnetod Jesu am Kreuz ein neues „Gesetz“ gegeben wurde, das das Gesetz des Mose für als endgültig beseitigt ansieht. In den vier Evangelienbüchern wird das zum Beispiel darin sichtbar, dass Jesus sich zum „Herrn des Sabbats“ erklärt, für die frommen Juden eine Gotteslästerung und in den Seligpreisungen der Bergpredigt das „neue Gesetz“ verkündigt, das in dem Doppelgebot der Liebe Gottes und des Menschen zusammengefasst wird.
So steht am Ende der Kapitel 10 – 13 des zweiten Korintherbrief, dem Predigttext dieses Sonntages, nach intensiver Auseinandersetzung mit seinen innerkirchlichen Gegnern und den davon betroffenen Gemeindegliedern die Aufforderung: „Grüßt euch untereinander mit dem Heiligen Kuss.“
Der Predigttext für den Pfingstsonntag (11. Mai) steht im Brief des Paulus an die Römer, Kapitel 8, die Verse 1 – 11
So gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind.
Denn das Gesetz des Geistes, der lebendig macht in Christus Jesus, hat dich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Denn was dem Gesetz unmöglich war, weil es durch das Fleisch geschwächt war, das tat Gott: Er sandte seinen Sohn in der Gestalt des sündigen Fleisches und um der Sünde willen und verdammte die Sünde im Fleisch, damit die Gerechtigkeit, vom Gesetz gefordert, in uns erfüllt würde, die wir nun nicht nach dem Fleisch leben, sondern nach dem Geist.
Denn die da fleischlich sind, die sind fleischlich gesinnt; die aber geistlich sind, die sind geistlich gesinnt. Aber fleischlich gesinnt sein ist der Tod, und geistlich gesinnt sind sein ist Leben und Friede. Denn fleischlich gesinnt sein ist Feindschaft gegen Gott, weil das Fleisch dem Gesetz Gottes nicht untertan ist, denn es vermag´s auch nicht. Die aber fleischlich sind, können Gott nicht gefallen. Ihr aber seid nicht fleischlich, sondern geistlich, wenn denn Gottes Geist in euch wohnt. Wer aber Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Wenn aber Christus in euch ist, so ist der Leib zwar tot um der Sünde willen, der Geist aber ist Leben um der Gerechtigkeit willen. Wenn nun der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird er, der Christus von den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen durch seinen Geist, der in euch wohnt.
Der Predigttext für den Pfingstsonntag ist dem gleichen Kapitel des Römerbriefes entnommen wie der des Sonntages zuvor. Die nicht fett gedruckten Teile des Predigttextes sind in Klammern gesetzt. Sie können beim Vorlesen und Predigen außer acht gelassen werden. Ich gebe sie um des gesamten Zusammenhanges und auch der Argumentationsweise willen des Paulus mit an.
Der 50. Tag nach Ostern ist zum Tag des Pfingstfestes geworden. Die intensive Gemeinschaft des auferstandenen Christus mit seinen Jüngern wird nun durch die Gabe des Heiligen Geistes zu einer Fortsetzung der Glaubensgeschichte des Volkes Gottes und jedes Glaubenden.
So ist Pfingsten auch als „Geburtstagsfest“ der Kirche zu verstehen. Diese geistvermittelte Christusgemeinschaft gewinnt eine soziale Gestalt. Die Pfingstgeschichte in der Apostelgeschichte erzählt, dass sich nach der Predigt des Petrus 3000 Menschen haben taufen lassen. So wird der Pfingsttag zum Gründungstag der christlichen Gemeinde.
Der Predigttext ist von zwei Gegensatzpaaren durchzogen: Geist und Fleisch; Leben und Tod.
Der Apostel Paulus wäre missverstanden, wenn eine Sicht des menschlichen Lebens gemeint sei, in der sich das geistliche Leben jenseits der körperlichen Erfahrung abspielt. Nach Vers 11 des Textes werden auch die sterblichen Leiber lebendig werden.. Der Geist Gottes wird dies in der Vorwegnahme der durch Christus eröffneten Welt Gottes möglich machen, wie es im Vers 1 gleich einem Paukenschlag formuliert ist: So gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus sind.
Damit nimmt Paulus den in Kapitel 7, Vers 6 ausgesagten Gedanken auf: Nun sind wir vom Gesetz frei geworden.
Der von Martin Luther mit „Fleisch“ übersetzte Begriff ist bei Paulus mehrdeutig. Es kann damit die körperliche Existenz eines Menschen gemeint sein. Weiter denkend entwickelt Paulus diesen Begriff aber so, dass er den Menschen als gottgewolltes Geschöpf begreift, aber auch als ein Opfer von Gewalt, sowie als Täter sieht, der sich und andere zerstört. Mit dem Begriff „Fleisch“ sind auch die verletzlichen Seiten des Menschseins benannt, die dem Kreislauf von Gewalt und Tod ausgesetzt sind.
Ein Theologe unserer Tage, Manfred Josuttis, beschreibt den Heiligen Geist als „Macht, die Menschen aus ihrem bisherigen Dasein herausreißt und ihnen neuen Existenzmöglichkeiten eröffnet“.
Im Römerbrief – so auch in unserem Predigttext – trägt Paulus seine „Lehre vom Gesetz“ vor.
Mit seinen judenchristlichen Gegnern ist er sich einig, dass der Tod Jesu, der als „Sühnetod“ verstanden wird, gegenüber dem jüdischen Sühneopferkult, wie er im Tempel von Jerusalem begangen wurde, eine wesentliche Veränderung darstellt.
Mit seinen judenchristlichen Gegnern ist er uneins darüber, ob die getauften Christen nach ihrer Taufe noch jüdische Reinheitsvorschriften und die jüdische Beschneidung weiter wahrnehmen müssen, um noch der Rechtfertigung im Endgericht teilhaftig zu werden.
Für Paulus, der nach der jüdischen Schrift- und Gesetzestradition erzogen ist und diese in der Anfangszeit gegen die für ihn „bösen Christen“ im Auftrag der jüdischen Religionsbehörde mit allen Machtmitteln durchzusetzen versuchte, vollzieht sich in der Begegnung mit dem gekreuzigten und auferstandenen Christus vor Damaskus eine Wende. Er erkennt, dass er diesen Christus falsch verstanden hat.
Aus dieser Begegnung und der damit verbundenen Offenbarung entwickelt sich bei Paulus ein neues Verständnis des „Gesetzes“.
In drei Schritten entwickelt Paulus sein „neues“ Gesetzesverständnis. Das „Gesetz“ ist nach jüdischem Verständnis die umfassende Lebensordnung, die den Tempelkult, das Gottesverhältnis und alles Leben in Israel bestimmt und dessen Kern die zehn Gebote darstellen. Dieses „Gesetz“ ist vor aller Schöpfung bei Gott vorhanden gewesen. Am Sinai ist es von Gott durch Mose dem Volk offenbart worden. Nach jüdischem Verständnis musste Jesus als messianischer Verführer dem Tod am Kreuz überantwortet werden.
Paulus versteht nach dem „Damaskuserlebnis“, dass Jesus entsprechend den Antithesen der Bergpredigt seine eigene messianische Sicht des Gotteswillens dem jüdischen Gesetzesverständnis gegenüberstellt.
Jesus nennt Gott seinen „Vater; die Nächsten- und Feindesliebe umschließt auch die Feinde;
er ist der „Herr des Sabbats“ und die Zusammenfassung des Gesetzes geschieht in dem Doppelgebot der Gottes- und Nächstenliebe.
Die paulinische Lehre vom Gesetz hat also ihr Vorbild in der messianischen Lehre Jesu vom Willen Gottes. Karfreitag, der Tag des Kreuzestodes Jesu wird nach Paulus zum großen Versöhnungstag für alle Glaubenden.
Diese Glaubenden leben nun nicht „gesetzeslos“, wie es die Gegner des Paulus behaupten, sondern sie können aus der Erkenntnis Gottes mit der Kraft des Hl. Geistes dessen Willen zeichenhaft erfüllen.
Die dritte Form des „Gesetzes“ ist für Paulus die heidnische Gesetzeslosigkeit, die er sowohl nach seinem jüdischen Vorverständnis als auch nach seinem christlichen Verständnis ablehnt.
Der Predigttext für den Sonntag Exaudi (4. Mai) steht im Brief des Paulus an die Römer, Kapitel 8, die Verse 26 – 30
Desgleichen hilft auch der Geist unserer Schwachheit auf. Denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie sich`s gebührt; sondern der Geist selbst vertritt uns mit unaussprechlichem Seufzen. Der aber die Herzen erforscht, der weiß, worauf der Sinn des Geistes gerichtet ist; denn er vertritt die Heiligen, wie es Gott gefällt.
Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Denn die er ausersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dass sie gleich sein sollten dem Bild seines Sohnes, damit dieser der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Die er aber vorherbestimmt hat, die hat er auch berufen; die er aber berufen hat, die hat er auch gerecht gemacht; die er aber gerecht gemacht hat, die hat er auch verherrlicht.
Der lateinische Name des sechsten Sonntages nach Ostern „Exaudi“ ist zu übersetzen mit „Höre, Herr“. In den Lesungen und Predigttexten wird der Abschied Jesu von dieser Welt und die Verheißung des Hl. Geistes thematisiert.
Der Predigttext nach der sechsten Predigtreihe ist ein Abschnitt aus dem Römerbrief. Dieser paulinische Brief ist nicht nur der erste, sondern auch der bedeutendste in der Reihe der neutestamentlichen Briefe. Mit ihm ist in besonderer Weise das Leben des Paulus und das der christlichen Kirche verknüpft. Die durch die Reformation entstandenen evangelischen Kirchen haben zu diesem biblischen Text ein ganz besonderes Verhältnis, weil Martin Luther über dem Studium des Briefes, besonderes des Abschnittes Kapitel 1, die Verse 16 und 17 zu der Erkenntnis von der Heil bringenden Gerechtigkeit Gottes gelangt.
Schon zu Lebzeiten Luthers wird deswegen der Römerbrief als „Zusammenfassung christlicher Lehre“ verstanden.
Es ist für die Auslegung des Römerbriefes wichtig, den geschichtlichen Hintergrund wahrzunehmen, weswegen er von Paulus geschrieben wurde. Nach der Apostelgeschichte Kapitel 20, Vers 3 und Römer Kapitel 16, 22f. verfasste Paulus diesen im Jahre 56 nach Christus in der Stadt Korinth. Dort befand er sich im Hause des Gaius. Der Zeitpunkt der Abfassung des Römerbriefes markiert einen Wendepunkt in seiner Missionstätigkeit. Im Ostern der Mittelmeerwelt war seine Tätigkeit erfolgreich gewesen. Seine Verpflichtung, für die christliche Gemeinde in Jerusalem eine Kollekte einzusammeln, stand vor dem Abschluss.
Nun wollte er seine Missionstätigkeit nach Westen hin, nach Spanien fortsetzen und die christliche Gemeinde in Rom sollte dazu als Ausgangspunkt dienen.
Das große Problem der paulinischen Missionstätigkeit, dass er in seiner „Theologie“ schärfsten Angriffen vonseiten der Judenchristen ausgesetzt war, die unter der Leitung des Bruders Jesu, dem Jakobus, eine Position vertraten, die jüdische Reinheits- und Speisevorschriften mit der christlichen Botschaft verbanden. Diese am „Gesetz des Mose“ festhaltenden Christen hatten sich zwar auf dem im Jahre 48 in Jerusalem stattgefundenen Apostelkonzil nicht durchsetzen können, setzten aber – unterstützt von Petrus – eine Art Gegenmission ins Werk. Ein besonderes biblisches Zeugnis für diese Auseinandersetzungen ist der im Neuen Testament befindliche Galaterbrief. Auch in der christlichen Gemeinde in Rom versuchen nun diese „Judenchristen“ gegen die nach ihrer Meinung zu sehr an den Interessen der „Heidenchristen“ angepasste Verkündigung des Paulus Stimmung zu machen. So heißt es Römer 3, 8, dass gewisse Leute den Paulus in Rom mit der Unterstellung „verlästern“, er predige „Lasst uns Böses tun, damit Gutes daraus komme“.
Diesen Verleumdungen und ihren Verursachern widerspricht Paulus auf Heftigste. Sollten seine Gegner in der christlichen Gemeinde Roms sich durchsetzen, so sind seine Missionspläne gescheitert. Er schreibt also den Brief, um die dortige Gemeinde über sein Evangelium und seine wahren Absichten zu informieren. Dies geschieht in der Hoffnung, dass er die beginnende Agitation der judenchristlichen Gegner noch abfangen kann.
Die „Gründer“ der christlichen Gemeinde in Rom sind unbekannt. Wahrscheinlich sind es Handwerker und Kaufleute gewesen, die von Jerusalem oder Antiochien nach Rom gekommen waren. Der christliche Glaube breitete sich zuerst unter den in Rom zahlreichen Juden und durch das Judentum angezogenen „Gottesfürchtigen“ aus. Deswegen kaum es zu Auseinandersetzungen in den jüdischen Versammlungs- und Gebetsräumen (Synagogen). Im Jahre 49 n. Chr. erließ der römische Kaiser Claudius eine Verordnung, in dem er die Anführer dieser Unruhen aus der Stadt verweisen ließ, wobei keine Unterschiede zwischen Juden und Judenchristen gemacht wurden. Die Folgen für die junge christliche Gemeinde waren, dass sie nur noch aus so genannten „Heidenchristen“ bestand, was wiederum für diese einen geringeren Rechtsstatus in der römischen Gesellschaft bedeutete. Wir können davon ausgehen, dass die Christen in Rom in Form einzelner Hausgemeinden organisiert waren. Mit dem Regierungsantritt des Kaisers Nero im Jahre 54 wurde die Verfügung des Claudius wieder aufgehoben, die vertriebenen Juden und Judenchristen konnten wieder zurückkehren, was wiederum große Probleme in der christlichen Gemeinde auslöste, da die Judenchristen den Konflikt um die Evangeliumsbotschaft des Paulus außerhalb Roms wahrgenommen hatten.
So befasst sich Paulus in dem gesamten Brief mit dem ihm anvertrauten Evangelium. Es ist ihm und allen anderen Aposteln anvertraut. Diese „frohe Botschaft“, so die Übersetzung des Wortes „Evangeliums“ hat seine Ursache in der von Gott veranlassten Sendung des Jesus Christus, seinem Sühnetod in der Kreuzigung, seiner Auferweckung und Erhöhung zur Rechten Gottes und seiner Bestellung zum Retter und Richter der Menschen. Zu dieser Überzeugung will Paulus auch in Rom stehen und macht dies gleich am Anfang seines Briefes in dem zentralen Satz Kapitel 1, Vers 16 deutlich.
Seine Gegner unterstellen ihm, dass er eine „billige Gnade“ verkündige. Diesen widerspricht er, indem er sie als Satansdiener bezeichnet. (Römer 16, 17)
Für Paulus ist es eine göttliche Gabe, die das Wissen und Wollen und die Lebensgestaltung des Menschen durch die Wirksamkeit des Jesus Christus neu machen. Von daher muss er die Überzeugung der Judenchristen ablehnen, die die Lebensgestaltung der Menschen von der Beachtung der Gebote – oder wie er es nennt: des Gesetzes – als einer religiösen Leistung abhängig machen.
Die fünf Verse des Predigttextes haben ihren inhaltlichen Zusammenhang mit dem Vers 18 des Kapitels. „Ich bin überzeugt, dass dieser Zeit Leiden nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll.“ Der gekreuzigte und auferstandene Christus wird den gegenwärtig Leidenden Anteil an der Herrlichkeit Gottes geben. Die Verse 26 und 27 unseres Predigttextes erläutern, weshalb die „Leidenden“ nicht zuschanden werden. Der erhöhte Christus ist in ihnen gegenwärtig. Er tritt für sie vor Gott ein und stärkt seine Gemeinde auf dieser Erde.
In den Versen 28 – 30 kommt Paulus nun auf den Vers 18 zurück. Er bestätigt die Glaubensgewissheit mit dem Dreiklang der Worte „berufen, gerechtfertigt und erlöst.“
Die christliche Handlung, die hinter diesen Worten steht, ist die der Taufe. In ihr sind die Christen nach Gottes freien Beschluss zum Heil berufen. Dieses Handeln Gottes ist für alle zukünftigen Zeiten bestimmend. Die Glaubenden brauchen deshalb keine Vorbehalte mehr zu machen. Gott hat ihnen in ihrer Taufe Anteil an seiner Herrlichkeit (Gerechtigkeit) gegeben.
So kann Paulus ausführen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten dienen, auch wenn sie in der gegenwärtigen Zeit noch Leiden erfahren müssen.
Der Predigttext für den Himmelfahrtstag (1. Mai) steht im Epheserbrief, Kapitel 1, die Verse 20b – 23
Durch sie (die Macht der Stärke) hat er (Gott) ihn von den Toten auferweckt und eingesetzt zu seiner Rechten im Himmel über alle Reiche, Gewalt, Macht, Herrschaft und alles, was sonst einen Namen hat, nicht allein in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen. Und alles hat er unter seine Füße getan und hat ihn gesetzt der Gemeinde zum Haupt über alles, welche sein Leib ist, nämlich die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt.
Der Himmelfahrtstag als selbständiger Festtag entwickelt sich erst im vierten nachchristlichen Jahrhundert. Bis dahin war das Gedächtnis der himmlischen Erhöhung Jesu Christi mit der Osterfeier verbunden.
Die Hochschätzung der Zahl 40, die die christliche Kirche aus den biblischen Schriften übernahm, dürfte mit zur Festlegung dieses Tages geführt haben. Besonders die Festlegung des Evangelisten Lukas für das Pfingstfest als dem 50. Tag nach Ostern dürfte die Beachtung des 40. Tages befördert haben.
Der Epheserbrief gilt nach allgemeiner Überzeugung als ein Werk eines Schülers des Paulus.
Weiter dürfte der Brief nicht an die Gemeinde in Ephesus gerichtet gewesen sein, denn diese von Paulus selbst gegründete Gemeinde ist dem Briefschreiber unbekannt. So könnte dieser „Brief“ ein Rundschreiben an christliche Gemeinden in Kleinasien gewesen sein, dessen Verfasser das theologische Erbe des Paulus bewahrt hat und mit großem Eifer weitergeben will.
Eine weitere Eigenheit dieses Lehrschreibens dürfte sein, dass in ihm keine bestimmten Nachrichten an bestimmte Leser enthalten sind, sondern es sich um eine theologische Abhandlung handelt. Weiter ist die Ähnlichkeit mit dem Kolosserbrief auffällig.
Beide haben einen grundsätzlichen Eingangsteil (Kol. 1 und 2; Epheser 1 – 3), dem jeweils ein ermahnender Teil folgt. (Kol. 3 und 4; Epheser 4 – 6) Dieses Schema entspricht der christlichen Predigt. Der durch Annahme Jesu Christi „neue“ Mensch zeigte sich in einem „neuen Gewand“, also einem entsprechenden Lebenswandel. Im Taufgottesdienst mit dem Bezeugen des Glaubensbekenntnisses und der Belehrung des Getauften zu einem neuen Lebenswandel hatte dieses „Muster“ der beiden Briefe seinen Ursprungsort.
Die Meditation über die Kirche als dem Leib Christi ist das zentrale Anliegen des Epheserbriefes.
Die beiden Briefe nehmen sehr stark die Gedankenführung einer bestimmten Geistesbewegung auf, mit der sich die frühen christlichen Gemeinden und deren Theologen auseinandergesetzt haben. Sie wird allgemein als „Gnosis“ bezeichnet. Ihre Ausbreitung vollzieht sich aus dem nahöstlichen Bereich in den Mittelmeerraum hinein. Im Urchristentum verbreiten sich stark die gnostischen Denkformen, nicht aber die gnostische Erlösungslehre. Anders ausgedrückt. Die Theologen der ersten nachchristlichen Jahrhunderts benutzen die Formen des Denkens, das Weltbild und die Vorstellung vom Vorgang der Erlösung, um die christliche Botschaft einer breiten gebildeten Schicht zeitgemäß zu verkünden.
Einige Motive der gnostischen Weltanschauung: Wir Menschen sind aus einer jenseitigen Lichtwelt in eine finstere Welt gestürzt. Unser materieller Körper umschließt wie ein Gefängnis den in uns festgehaltenen Lichtfunken, der unser wahres Sein ist. Aus der Lichtwelt kommt ein Erlöser, der den erlöst, der den Lichtfunken in sich trägt – nicht jeder Mensch besitzt ihn. Bestimmte Menschen sind erweckte Himmelswesen, die das irdische Dasein verlassen und dem Erlöser gleich sind. Die Erlösung geschieht also nicht – wie in der christlichen Vorstellung – durch eine freie Tat Gottes, sondern ist letzten Endes das Werk des Menschen.
Im Epheserbrief wird das Weltbild der Gnosis sichtbar. Sie ist nicht ein Gebäude mit drei Flächen (Himmel – Erde – Unterwelt), sondern eine von Sphären des Himmels überspannte Flächen, die sich nach oben in die Himmelsräume erstrecken. Es gibt keine „Unterwelt“, sondern die teuflischen Mächte befinden sich in der untersten Schicht der Himmel, dem Luftraum über der Erde. Menschliches Leben geschieht so, dass es den „Himmeln“ und den in ihnen waltenden Mächten ausgesetzt ist.
Kirche ist nach der Vorstellung des Schreibers des Epheserbriefes der Leib Christi, der von „oben“, der obersten Sphäre göttlicher Macht bis in die Lebenswelt des Menschen hineinragt. Der Mensch lebt zwar noch in der untersten Sphäre, in der er den „bösen“ Mächten ausgesetzt ist, aber er kann mit ihnen kämpfen und sich ihnen widersetzen, da die Gegenwart Christi in der kosmischen Gestalt der Kirche ihm einen neuen Lebensraum gibt.
Der Predigttext beginnt mit einem Teil des Glaubensbekenntnisses, in dem die objektive Heilstat Gottes an Christus zitiert wird, dem sich in den Versen 20 – 23 eine dichterische Meditation über diesen Teil des Glaubensbekenntnisses anschließt.
Im Vers 22 wird zum ersten Mal im Epheserbrief einer der tragenden Begriffe eingeführt. Christus ist nicht nur das Haupt der Kirche, sondern des Kosmos. Diese uns fremd klingende Ausdrucksweise will deutlich machen, dass Christus als dem Herrn des Kosmos alles unterworfen ist, in der Kirche ist man Christus unterstellt, also befinden sich die Christen in seinem Schutzraum und sind den Mächten des Bösen nicht mehr ausgeliefert. In dieser Sprach- und Vorstellungswelt sind deutlich die Denkformen der Gnosis wahrzunehmen, die in der Umgebung der Adressaten des Epheserbriefes spürbar ist.
Der Predigttext für den Sonntag Rogate (27. April) steht im 2. Buch Mose, Kapitel 32, die Verse 7 – 14
Der Herr aber sprach zu Mose: Geh, steig hinab; denn dein Volk, das du aus Ägyptenland
geführt hast, hat schändlich gehandelt. Sie sind schnell von dem Wege gewichen, den ich ihnen geboten habe. Sie haben sich ein gegossenes Kalb gemacht und haben´s angebetet und ihm geopfert und gesagt: Das ist dein Gott, Israel, der dich aus Ägyptenland geführt hat. Und der Herr sprach zu Mose: Ich sehe, dass es ein halsstarriges Volk ist. Und nun lass mich, dass mein Zorn über sie entbrenne und sie vertilge; dafür will ich dich zum großen Volk machen.
Mose aber flehte vor dem Herrn, seinem Gott und sprach: Ach Herr, warum will dein Zorn entbrennen über dein Volk, das du mit großer Kraft und starker Hand aus Ägyptenland geführt hast? Warum sollen die Ägypter sagen: Er hat sie zu ihrem Unglück herausgeführt, dass er sie umbrächte im Gebirge und vertilge sie vor dem Erdboden? Kehre dich ab von deinem grimmigen Zorn und lass dich des Unheils gereuen, das du über dein Volk bringen willst. Gedenke an deine Knechte Abraham, Isaak und Israel, denen du bei dir selbst geschworen und verheißen hast: Ich will eure Nachkommen mehren wie die Sterne am Himmel, und dies ganze Land, das ich verheißen habe, will ich euren Nachkommen geben, und sie sollen es besitzen für ewig. Da gereute den Herrn das Unheil, das er seinem Volk zugedacht hatte.
Der Name dieses Sonntages „Rogate = Betet“ ist nicht der Anfang eines Psalmes, sondern dürfte von den Bittprozessionen herkommen, die im 4. nachchristlichen Jahrhundert in Rom eingeführt wurden. Solche Prozessionen, bei denen um die Fruchtbarkeit der Erde und das Gelingen der menschlichen Arbeit – besonders in der Landwirtschaft - gebeten wurde, waren auch in nichtchristlichen Kulturen verbreitet.
Nach evangelischem Verständnis ist dieser Sonntag durch das Thema „Gebet“ bestimmt. Dieses Thema greifen die Lesungen und Predigttexte dieses Sonntages, zu denen in der diesjährigen sechsten Predigtreihe ein Abschnitt aus dem 2. Buch Mose gehört, der auch als alttestamentliche Lesung in unseren Gesangbüchern abgedruckt ist.
Der Predigttextabschnitt gehört in den Zusammenhang der Kapitel 31, Vers 18 bis Kapitel 34, Vers 35 des zweiten Buches Mose. In diesem Abschnitt geht es um den Abfall des Volkes Israel und den erneuten Bundesschluss Gottes mit diesem. Das Thema der zerbrochenen und erneuerten Gesetzestafeln hält diesen Abschnitt zusammen. Am Ende des Kapitels 34 (Verse 27 und 28) erst wird berichtet, was auf den Tafeln stand, zu deren Empfang Mose auf den Berg gestiegen war.
Der Abschnitt 9 – 14 dürfte inhaltlich einen besonderen Schwerpunkt im Kapitel 32 darstellen. Dieser Abschnitt findet seine Entsprechung im 1. Buch der Könige, Kapitel 12, Vers 28f. Dort wird erzählt, dass der König Jerobeam I. (926 – 907 vor Christus) in den Heiligtümern Bethel und Dan zwei „goldene Kälber“ aufstellen lässt.
Die unter den Königen David und Salomo vereinigten Stämme Israels zerfallen nach dieser Zeit in den Bereich des 10 Stämme unfassenden Nordreiches mit den Kultorten Bethel und Dan und das zwei Stämme umfassende Südreich mit dem Kultort Jerusalem. (Die Trennung in die beiden politisch selbständigen Bereiche wird im Kapitel 12 des ersten Königsbuches erzählt.)
Beide Texte (2. Buch Mose und 1.Könige) machen deutlich, dass in der Volks- und Religionsgeschichte Israels es einen Prozess der religiösen Identitätsfindung gab. In den Schriften des Alten Testamentes wird der religiöse falsche Weg als „Untreue“ und „Abfall“ von dem Gott Israels angesehen.
Der besondere inhaltliche Schwerpunkt des Predigttextes liegt auf der Gestalt des Mose. In den Versen 7 – 10 redet Gott und Mose schweigt. Der Vorwurf Gottes an Mose ist, dass das Volk die Abwesenheit des Mose und das damit scheinbar verbundene Schweigen Gottes nicht aushalten kann. „Gott ist mit sich selbst beschäftigt; also machen wir uns unseren Gott.“
Die Antwort des Mose ist bemerkenswert: Er klagt Gott an. „Du hast das Volk aus Ägypten herausgeführt und damit haben sie die Götter der anderen Völker kennen gelernt.“
Mose gibt Gott Befehle. „Kehr um“, „Ändere deine Gesinnung“, „Erinnere dich“. So reden die Propheten gegenüber dem Volk. Mose redet wie ein Prophet zu Gott. Damit erinnert er Gott an seine eigenen Worte, die dieser zu Abraham, Jakob und Isaak gesagt und behaftet ihn damit.
Gott ändert seine Gesinnung. So wird es in dieser fiktiven Erzählung mitgeteilt, an der zwar das Volk in der Wüste nicht teilhat, sondern „nur“ die Leser der alttestamentlichen Erzählung. Wir sollen erfahren, dass der wahre Prophet, der Gottesmann der ist, der sich auf der Seite derer befindet, für die er zu beten und bitten bereit ist.
Unter diesem Gesichtspunkt gilt es das „Vater unser“, das Gebet des Herrn Jesus Christus nachzusprechen und nachzudenken.
Der Predigttext für den Sonntag Kantate (20. April) steht in der Offenbarung des Johannes, Kapitel 15, die Verse 2 – 4
Und ich sah, und es war wie ein gläsernes Meer, mit Feuer vermengt; und die den Sieg behalten hatten über das Tier und sein Bild und über die Zahl seines Namens, die standen an dem gläsernen Meer und hatten Gottes Harfen und sangen das Lied des Mose, des Knechtes Gottes, und das Lied des Lammes:
Groß und wunderbar sind deine Werke, Herr, allmächtiger Gott! Gerecht und wahrhaftig sind deine Wege, du König der Völker. Wer sollte dich, Herr, nicht fürchten und deinen Namen nicht preisen? Denn du allein bist heilig! Ja, alle Völker werden kommen und anbeten vor dir, denn deine gerechten Gerichte sind offenbar geworden.
„Kantate“ = Singet dem Herrn ein neues Lied! (Psalm 98, Vers 1,) das ist der Name und die inhaltliche Bedeutung dieses Sonntages. Der Predigttext ist ein Abschnitt aus dem letzten Buch unserer Bibel, der Offenbarung des Johannes. Dieses Buch mit seinen eindringlichen und auch oft Angst bereitenden Bildern hat durch die Geschichte der Christenheit hindurch immer eine besondere Faszination auf Freikirchen und religiöse Sondergemeinschaften ausgeübt.
Oft ist das Offenbarungsbuch wie ein Fahrplan benutzt worden, um Tag und Stunde der Endzeit dieser Welt zu wissen.
Keine andere Schrift des Neuen Testamentes redet so wie dieses vom Ablauf der Geschichte von der Auferstehung und der Erhöhung Jesu Christi bis zu seiner Wiederkunft und der Errichtung seiner Herrschaft. Diese „apokalyptische“ Weltsicht war im Judentum der damaligen Zeit vorhanden. Unter furchtbaren Katastrophen geht die Welt zugrunde und die paradiesiche Welt Gottes wird entstehen. Diese „dualistische“ Weltsicht sah die vorhandene Welt unter der Macht satansicher Mächte stehen, die Kriege, Teuerung, Unordnung des Kosmos und der menschlichen Lebensmöglichkeiten auslösen. In der größten Not aber wird Gott eingreifen. Die Gräber öffnen sich, die Toten stehen auf und alle Menschen müssen vor dem Gericht Gottes erscheinen. Der richtende Messias wird über ewiges Heil und ewige Verdammnis entscheiden und Gott lässt an die Stelle der alten eine neue Welt treten, in der die zum ewigen Heil Berufenen mit Gott leben werden.
In geheimen Offenbarungen sind den Apokalyptikern die Pläne Gottes bekannt gemacht worden.
Im Alten Testament findet sich mit dem Buch Daniel das im zweiten vorchristlichen Jahrhundert abgefasste älteste Buch der biblischen Schriften.
Unstrittig ist, dass das Buch der Offenbarung, das in Gestalt eines Briefes an sieben christliche Gemeinden Kleinasien (heutige Türkei) gerichtet ist, nicht von dem Evangelisten Johannes verfasst worden ist.
Es dürfte sich aber zweifelsfrei um eine Persönlichkeit mit großer Autorität gehandelt haben, die in den angesprochenen Gemeinden gepredigt hat. Seine Verwurzelung im alttestamentlich-jüdischen Erbe weisen auf eine Person hin, die aus dem jüdischen Kerngebiet stammen könnte. Die Entstehungszeit des Buches der Offenbarung ist aller Wahrscheinlichkeit nach am Ende der Regierungszeit des römischen Kaisers Domitian (81 – 96 nach Christus) anzusetzen. Domitian ist es, der zu seinen Lebzeiten göttliche Verehrung durch alle Bewohner des römischen Reiches fordert. Den Christen, die schon Leidenszeiten hinter sich gebracht haben, stehen neue bevor. So ist das Buch des „Sehers“ Johannes als ein Trost- und Mahnbuch an die unter großer Verfolgung stehenden Gemeinden Kleinasiens zu verstehen.
Auffallend ist, dass in der apokalyptischen Literatur verschiedene Zahlen mit einer bestimmten Bedeutung verbunden sind. So beginnt der erste Vers des 15. Kapitels mit der zweimaligen Nennung der Zahl sieben. Nach der im Vorderen Orient sehr verbreiteten babylonischen Gestirnsreligion wurden die damals bekannten sieben Gestirne als Gottheiten verehrt, die den Lauf des Kosmos bestimmen. Die Zahl sieben ist demnach diejenige, die für die Vollkommenheit der göttlichen Herrschaft steht.
Das Ende der jetzigen Welt steht unmittelbar bevor. Eine Reihe von Ereignissen muss noch geschehen. Diese Geschehnisse werden nun als Hinweis auf göttliches Handeln in einer Siebenerreihe aufgebaut.
Dem himmlischen Vorspiel in Vers 1 folgen zwei Szenen, deren erste unseren Predigttext in den Versen 2 – 4 umfasst. Die himmlischen Chöre (siehe auch 7, 9ff.) stehen vor Gottes Thron auf dem „gläsernen Meer“; das ist das Himmelsgewölbe. Der von den Engeln angestimmte Hymnus, der den Sieg Gottes preist, ist aus einer Reihe alttestamentlicher Texte zusammengesetzt. (Z. B. Psalm 139, 14; Psalm 111, 2 u.a.)
So wie einst die Israeliten nach dem Durchzug durch das Rote Meer das Lob Gottes sangen, so rühmen die, die durch Christus (in den Bildern der Offenbarung: das Lamm) gerettet sind, diese helfende Tat Gottes.
Lieder haben in der Geschichte der Kirche und der persönlichen Frömmigkeit ihre eigene Bedeutung. Oft begleiten Menschen bestimmte Lieder durch das gesamte Leben und erweisen sich in den unterschiedlichsten Situationen als große Hilfe.
So erklingen die alten Lieder immer wieder von neuem und zeigen ihre geistliche Kraft.
(
Der Predigttext für den Sonntag Jubilate (13. April) steht in der Apostelgeschichte, Kapitel 17, die Verse 22 – 28a
Paulus aber stand mitten auf dem Areopag und sprach: Ihr Männer von Athen, ich sehe, dass ihr die Götter in allen Stücken sehr verehrt. Ich bin umhergegangen und habe eure Heiligtümer angesehen und fand einen Altar, auf dem stand geschrieben: Dem unbekannten Gott. Nun verkündige ich euch, was ihr unwissend verehrt.
Gott, der die Welt gemacht hat und alles, was darin ist, er, der Herr des Himmels und der Erde, wohnt nicht in Tempeln, die mit Händen gemacht sind. Auch lässt er sich nicht von Menschenhänden dienen wie einer, der etwas nötig hätte, da er doch selber jedermann Leben und Odem und alles gibt. Und er hat aus einem Menschen das ganze Menschengeschlecht gemacht, damit sie auf dem ganzen Erdboden wohnen, und er hat festgesetzt, wie lange sie bestehen und in welchen Grenzen sie wohnen sollen, damit sie Gott suchen sollen, ob sie ihn wohl fühlen und finden können und fürwahr, er ist nicht ferne einem jeden unter uns. Denn in ihm leben, weben und sind wir.
„Jubilate“ = Jauchzet Gott, alle Lande (Psalm 66, Vers 1) ist der Name des dritten Sonntages nach dem Osterfest. Der Predigttext ist ein herausragender Abschnitt der Apostelgeschichte: die Rede des Paulus auf dem Areopag. Der vorgesehene Abschnitt kann um den in Klammern gesetzten Teil der Verse 28b – 34 erweitert werden. Dadurch wäre eine Akzentverschiebung möglich, in der das Thema der Auferstehung als Teil der intellektuellen Auseinandersetzung des Paulus mit den Philosophen angesprochen wird.
Ich beschränke mich auf den Textteil der Verse 22 – 28a.
In dem zweiten Teil des lukanischen Werkes aus Evangelium und Apostelgeschichte ist ab Kapitel 15, Vers 35 diese statt der Geschichte der Apostel eine Paulusgeschichte. Die zweite Missionsreise des Paulus ist nach dem Apostelkonzil in Jerusalem als Visitationsreise gedacht, um den Zustand der auf der ersten Reise gegründeten Gemeinden zu überprüfen.
Diese Reise führt Paulus und seine Begleiter über den Bosporus in den Teil des römischen Weltreiches, der heute Teil des europäischen Kontinentes ist. Nach Kapitel 17, Vers 16 hält sich Paulus in Athen auf, weil er auf Silas und Timotheus wartet. Damit wird deutlich, dass Athen weder als Ziel noch als Zentrum der paulinischen Missionstätigkeit angesehen wird. Trotzdem wird dieser Athener Aufenthalt als Höhepunkt seiner Tätigkeit angesehen, denn er redet nicht nur in der Synagoge vor Juden und Gottesfürchtigen, sondern auf dem Markt – der Agora – vor Heiden. Die Philosophen, die hier als Repräsentanten des reinen Heidentums angesprochen werden, kommen nur hier vor.
Nach Vers 16 sind es Vertreter der Philosophenschulen der Epikureer und Stoiker, denen Paulus „das Evangelium von Jesus und der Auferstehung verkündigt.“ Er tritt also als Prediger und nicht als Philosoph auf.
Entsprechend der sprichwörtlichen „Neugier“ laden diese ihn ein, ihnen die unbekannten religiösen Neuigkeiten mitzuteilen. Es geht also den Philosophen nicht um Erkenntnis und Wahrheit.
Die Verse 22 – 23 knüpfen nun an die vorher beschriebene Situation an. Die einzige Rede an die Heiden. Sie ist keine Missionsrede. Die Verkündigung des Evangeliums fehlt vollständig.
Die Anrede ist nicht „Brüder“, wie sie Christen, Juden und Gottesfürchtigen ziemt, sondern „Ihr Männer von Athen“
Die Charakteristik der Athener als „gottesfürchtig“ kann auch als „abergläubisch“ verstanden werden, denn Paulus hat in Athen eine Vielzahl von Götterbildern und Statuen wahrgenommen, mit denen sogar eine unbekannte Gottheit verehrt wird. Dies ist für ihn – Paulus – ein Hinweis auf ihre Unwissenheit.
Paulus nimmt nun den Gedanken eines allgemeinen Gottesbewusstseins auf, wenn er in Vers 28a die popularwissenschaftliche Vorstellung zitiert, dass „Gott nicht ferne ist ein jedem von uns. Denn in ihm leben, weben und sind wir.“
Paulus versteht aber diese allgemeine Gottesverwandtschaft der Menschen nicht so, dass wir alle etwas Göttliches in uns haben, sondern dass alles Leben auf Gott, den Schöpfer zurückgeht. Der Altar mit der Aufschrift „Dem unbekannten Gott“ weist auf einen undifferenzierten Polytheismus hin, dem Paulus den einzigen Gott entgegensetzt, der Himmel und Erde geschaffen hat. Dieser Gott wohnt nicht in Tempeln, die von Menschen gemacht sind, sondern die Menschen wohnen in seinem „Gebäude.
Dieser Gott lässt sich auch nicht von Menschen bedienen, denn er gibt allen Leben und Atem.
Wenn Gott also nichts benötigt, kann man ihm keine Opfer schenken, sondern nur Dank und Gebet.
Paulus entwickelt den biblischen Schöpfungsgedanken so, dass er für griechische Zuhörer verständlich ist. Die gesamte menschliche Existenz ist darauf angelegt, Gott zu suchen. Im Alten Testament wird diese Forderung immer wieder an das Volk Israel gestellt. Hier wird nicht gesagt, wie das geschehen soll. Aber das Wissen um das Sein Gottes sollte auf jeden Fall zur Gottesverehrung führen. Alles andere wäre Abgötterei.
Der Predigttext für den Sonntag Misericordias Domini (6. 4.) steht im Hebräerbrief, Kapitel 13, die Verse 20 und 21
Der Gott des Friedens aber, der den großen Hirten unserer Schafe, unsern Herrn Jesus, von den Toten heraufgeführt hat durch das Blut des ewigen Bundes, der mache euch tüchtig in allem Guten, zu tun seinen Willen, und schaffe in uns, was ihm gefällt, durch Jesus Christus, welchem sei Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit! Amen.
„Misericordias Domini“ = Der Güte des Herrn ist voll die Erde (Psalm 33, 5); so lautet der Name des zweiten Sonntages nach Ostern.
Die Texte dieses Sonntages nehmen das christologische Motiv des „Guten Hirten“ auf.
In der damaligen Welt war das Bild vom Hirten das, was für eine besondere Qualität geistlicher und politischer Führung stand. Im Psalm 23 hat dies bis auf den heutigen Tag seine eindrucksvollste sprachliche Form gefunden.
Im Vorderen Orient war der Viehbestand der Nomaden (Schafe, Ziegen, Kamele) das wichtigste Wirtschaftsgut, von dessen Wohlergehen die Existenz und die Zukunft der Menschen abhing. Gefahrenabwehr, Schutz und Orientierung galten als die wichtigsten Aufgaben und Fähigkeiten „guter“ Hirten. Die gegenteilige Erfahrung der „schlechten“ Hirten bestand in der Flucht vor auftretenden Gefahren oder der Bereicherung auf Kosten der Besitzer der Tiere.
So ist das Hirtenmotiv bis auf den heutigen unbeschadet der veränderten politischen und geistlichen Veränderungen ein Ausdruck für die Qualität der Führungseliten geblieben.
Am Ende des Hebräerbriefes steht dieses gewaltige Satzkonstrukt. Es ist ein Segenswunsch, der in ein Gotteslob mündet. Der Hebräerbrief will ja eine Christuspredigt sein. So beginnt er in Kapitel 1 „Gott in diesen letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn“. Mit den Schlussversen will der Verfasser an das Thema seines Schreibens erinnern und noch einmal mit aller Deutlichkeit dieses ins Bewusstsein bringen.
In diesem Segenswunsch werden noch einmal die Themen sichtbar, die in dem Schreiben angesprochen wurden: Opfertod und Erhöhung Jesu Christi; die neue Existenz im Glauben; die Stiftung des neuen Bundes durch das Opfer Jesu Christi.
Die wesentlichen Inhalte des Glaubens werden hier zusammengefasst. Eine Aussage über Gott steht am Anfang (Der Gott des Friedens); es folgen christologische Aussagen (Jesus, von den Toten heraufgeführt) und den Menschen errettende Hinweise (der mache euch tüchtig zu allem Guten).
Eine „Kurzformel des Glaubens“ in der man trinitarische Schritte (Vater, Sohn, Hl. Geist) erkennen kann.
Der Gott des Friedens ist das handelnde Subjekt des Predigtsatzes. Der Hebräerbrief entfaltet den Gedanken des Friedens besonders in den Kapitel 4, 14 – 10, 39. Karfreitag ist für die Christen der Tag und das Ereignis, das im jüdischen Bereich der große Versöhnungstag ist.
Christus ist der wahre „Hohepriester“, der in seinem Selbstopfer die Versöhnung mit Gott herstellt und damit den mit Gott Versöhnten den Weg zu diesem eröffnet. Der Frieden mit Gott ist die Voraussetzung allen Friedens. Diesen dürfen sich die Christen schenken lassen.
Ähnlich wie im Johannesevangelium (Kapitel 10) wird im Hebräerbrief die Selbsthingabe Jesu Christi als besonderes Merkmal des „guten Hirten“ für die ihm anvertrauten Schafe beschrieben.
Der Predigttext für den Sonntag Quasimodogeniti (30. März) steht im Buch des Propheten Jesaja, Kapitel 40, die Verse 26 – 31
Hebt eure Augen in die Höhe und seht! Wer hat dies geschaffen?
Er führt ihr Heer vollzählig heraus und ruft sie alle mit Namen; seine Macht und starke Kraft ist so groß, dass nicht eins von ihnen fehlt.
Warum sprichst du denn, Jakob, und du, Israel, sagst: „Mein Weg ist dem Herrn verborgen, und mein Recht geht vor meinem Gott vorüber“? Weißt du nicht? Hast du nicht gehört?
Der Herr, der ewige Gott, der die Enden der Erde geschaffen hat, wird nicht müde noch matt, sein Verstand ist unausforschlich.
Er gibt dem Müden Kraft, und Stärke genug dem Unvermögenden.
Männer werden müde und matt, und Jünglinge straucheln und fallen; aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden.
Aus der frühen Zeit der christlichen Kirche (3./4. Jahrhundert) ist bekannt, dass mit dem „Weißen Sonntag“ die achttägige Feier des Osterfestes abgeschlossen wurde. Die Woche von Ostern bis zu diesem Sonntag wurde auch als „Weiße Woche“ begangen, da die in der Osternacht Getauften ihre weißen Taufkleider trugen. Sie wurden täglich tiefer in das Verständnis der Sakramente eingeführt.
Aus dieser frühchristlichen Praxis sind bis heute die katholische Feier der Erstkommunion bzw. die evangelische Feier der Konfirmation in der Nähe dieses Sonntages übrig geblieben.
Im lateinischen Namen des Sonntages „Quasimodogeniti“; zu deutsch: „Wie die neugeborenen Kinder“ wird der Bezug zur österlichen Taufe noch hergestellt.
Nach der Predigtreihenordnung dieses Kirchenjahres – der sechsten Predigtreihe – ist ein Abschnitt aus dem Buch des Propheten Jesaja der Predigttext. Es ist die gleichzeitig die alttestamentliche Lesung dieses Sonntags. (In unserem Gesangbuch unter der Nummer 954.34 zu finden.)
Die Kapitel 40 – 55 des insgesamt 66 Kapitel umfassenden Jesajabuches stellen einen eigenen Textabschnitt dar. Unter dem programmatischen Namen Jesaja „Jahwe (Gott) rettet“ werden drei selbständige Prophetenbücher zusammengefasst, von denen das mittlere die Kapitel 40 – 55 umfasst. Den wirklichen Namen des oder der Propheten dieses biblischen Textteiles kennen wir nicht. Aus dem Text lässt sich aber die geschichtliche Situation erkennen, in die dieser geschrieben ist.
Im Jahre 587 vor Christus wird mit der Zerstörung Jerusalems durch das babylonische Großreich (auf dem Gebiet des heutigen Irak) der noch verbliebene selbständige Teil des Volkes Israel beseitigt. Die Oberschicht wird nach Babylon (Bagdad) weggeführt und dort in der Nähe der Hauptstadt angesiedelt.
Nach dem Tod des babylonischen Königs Nebukadnezar im Jahre 563 beginnt der politische Niedergang dieses Großreiches. Das benachbarte medische (persische) Reich wird immer stärker. 539 vor Christus erobert der persische König Kyros Babylon.
Diese weltgeschichtlichen Veränderungen begleiten zwei Propheten. Es sind der Prophet Hesekiel und der namentlich unbekannte Verfasser unseres Textes.
Die Zahl der nach Babylon verbrachten Angehörigen der Oberschicht ist nicht sicher. Manche Zahlen sprechen von 12 – 15 000. Es sind also auch Angehörige des Volkes Israel im Land geblieben. Die Deportation führender Schichten sollte den im Landes wohnenden die Möglichkeit zur Gestaltung eines politisch und kulturell eigenständigen Lebens nehmen.
Die Deportierten konnten im fremden Land in eigenen Siedlungen wohnen und ein eigenständiges Leben führen. Nirgendwo ist in den alttestamentlichen Schriften davon die Rede, dass die Israeliten zur Anbetung der babylonischen Götter genötigt wurden. So dürfte auch der Gottesdienst weitergeführt worden sein. Da das Opferritual am Tempel wegfiel, verlagerte sich der Schwerpunkt der Gottesdienste auf das „Wortelement“; der Synagogengottesdienst entsteht. Die theologische Krise der Zeit der babylonischen Gefangenschaft dürfte darin zu sehen sein, dass die von Jerusalem Weggeführten in der Zerstörung des Tempels das Ende des Wirkens Gottes für sein Volk sahen. Die Götter Babylons waren die Sieger. Der in Babylon gepflegte Religionskult übte seine Wirkung aus. Der bisherige Glaube zerbrach. Viele wandten sich den neuen Göttern zu.
Die Sprache dieses Teiles des Jesajabuches hat einen erweckenden und aufrüttelnden Charakter. Die Häufung der Imperative macht dies besonders deutlich. Diese Kapitel 40 – 55 sind Erweckungspredigt.
Zu Beginn des 40. Kapitels wird dies deutlich, wenn es in Vers 8 heißt: „Das Gras verdorrt, die Blume verwelkt; aber das Wort unseres Gottes bleibt ewiglich.“
Deuterojesaja gehört in die Gruppe der Prophetenbücher des Alten Testamentes. Seine Vorgänger im 8. und 7. Jahrhundert vor Christus waren Gerichtspropheten. Ihre Ankündigung des Falles von Jerusalem wegen des Ungehorsams des Volkes war eingetreten. Nun geschieht in der Verkündigung der Kapitel 40 – 55 Heilsprophetie. Damit wird ein wesentliches Element der Prophetie Israels sichtbar. Prophetie ist nicht Vorhersagen bestimmter Ereignisse, sondern Zusage des Wortes Gottes in eine bestimmte geschichtliche Situation des Volkes hinein. Das Heilswort dieses unbekannten Propheten heißt: Fürchte dich nicht.
Dieses Heilswort geschieht als Zusage. „Der Herr hat Jakob erlöst und ist herrlich in Israel.“ (44, 23) und deswegen – so könnte man mit dem ersten Vers unseres Predigttextes fortfahren: „Hebt eure Augen in die Höhe und seht!“ Dieser imperativische Satz weist auf den Schöpfergott hin, der der Befehlshaber eines unermesslichen Heeres der Sterne ist. Jeder einzelne Stern ist sein Geschöpf. Damit steht dieser Text im Zusammenhang eines größeren Abschnittes, der mit dem Vers 12 beginnt. In drei Teilen (12 – 17; 18 – 24; 25 – 26) entfaltet der Prophet das Wirken Gottes als Schöpfer und setzt dieses gegen die Verzagtheit des Volkes Israel in der Fremde. (Der Glaube an die Gestirnsgötter Sonne, Mond und Sterne im babylonischen Reich stellte eine besondere Herausforderung dar. Aus diesem Grund wird dieser „andere“ Schöpferglaube im Kapitel 40, ab Vers 12 besonders thematisiert.) Die Verzagtheit des Volkes wird in Vers 27 deutlich, wenn ein Satz aus der Volksklage zitiert wird: Warum sprichst du denn, Jakob, und du, Israel, sagst: „Mein Weg ist dem Herrn verborgen, und mein Recht geht vor meinem Gott vorüber?“
Diese Klagen finden sich vielfältig in den Psalmen wieder. Diese Klagepsalmen sind Teil des gottesdienstlichen Geschehens gewesen.
Die Verse 29 – 31 sind der Abschluss und Höhepunkt der Verse 12 – 31 dieses Kapitels. Müde und ohnmächtig, wie das Volk im Exil sich erlebt; müde und ohnmächtig wegen ihres angefochtenen und zerstörten Glaubens sollen sie von den Worten des Trostes auf den Weg der Ermutigung und des Lobes gebracht werden.
Den „Müden“ und „Unvermögenden“ begegnet das umwandelnde Handeln Gottes. So beginnt dieser Prophet seine Rede. „Tröstet, tröstet mein Volk! spricht euer Gott“ (40, 1)
Damit wird die österliche Perspektive dieses alttestamentlichen Textes deutlich. In eine todtraurig, lebensmüde Welt fällt das Licht der Erlösung. Die Unerforschlichkeit und Unfassbarkeit Gottes wird darin spürbar, dass seine tiefe Lebendigkeit „unermüdlich“ die Müdigkeit und die Klage bestreiten.
So mündet der Zweifel des Thomas in der Evangeliumserzählung dieses Sonntages aus dem Johannesevangelium in das Bekenntnis: „Mein Herr und mein Gott!“
Der Predigttext für den Sonntag Palmarum (16.3) steht im Hebräerbrief,
Kapitel 12, die Verse 1 – 3
Darum auch wir: Weil wir eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, lasst uns ablegen alles, was uns beschwert, und die Sünde, die uns ständig umstrickt, und lasst uns laufen mit Geduld in dem Kampf, der uns bestimmt ist, und aufsehen auf Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens, der obwohl er hätte Freude haben können, das Kreuz erduldete und die Schande gering achtete und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes. Gedenkt an den, der so viel Widerspruch gegen sich von den Sündern erduldet hat, damit ihr nicht matt werdet und den Mut nicht sinken lasst.
Alle vier Evangelien berichten davon, dass Jesus vor Ostern feierlich in Jerusalem einzieht.
Matthäus und Johannes sehen in dem benutzten Reittier die Erfüllung einer Verheißung aus dem Buch des Propheten Sacharja (9, 9). Von den Jesus begleitenden Menschen wird er als messianischer König anerkannt und bejubelt. Sie breiten die Kleider auf dem Weg aus und streuen Palmzweige vor ihm aus.
In der frühen christlichen Kirche stand dieser Sonntag in der Vorbereitung auf Ostern und die
Tauffeiern. Die Taufbewerber wurden mit Salböl gesalbt und erhielten das Glaubensbekenntnis. Um 600 nach Christus kommt es zur Nachahmung und Darstellung des Einzugsgeschehens. Heute werden besonders in den katholischen Gemeinden blühende Zweige geweiht und in einem feierlichen Einzug mit in den Gottesdienst getragen.
Der Predigttext ist wieder – wie am Sonntag vorher – aus dem Hebräerbrief.
Die Verse 1- 3 des 12.Kapitels sind eine sich geschlossene thematische Einheit. Der Glaubensweg der Vorfahren aus der jüdischen Glaubens- und Volksgeschichte, wie er im Kapitel 11 dargestellt ist, wird nun auf die christliche Gemeinde übertragen. Die „Wolke der Zeugen“ – einer Begrifflichkeit aus der damaligen Rechtsgeschichte – sollen als Zeugen der Wahrheit und des Rechts gegenüber einem Richter für ihre Überzeugung glaubwürdig einstehen.
Der Glaubensweg der Christen wird mit dem Bild eines sportlichen Kampfes – eines Marathonlaufes – in Beziehung gesetzt. Der Hebräerbrief betont vor allem das Durchhalten und das Bestehen der Christen in dem Kampf, der ihnen aufgetragen ist. Sie sind – so das Bild von der „Wolke der Zeugen“ wie der Sportler von der Menge von Menschen umgeben, die die Kämpfenden anspornt.
So angespornt, sollen die im Glaubenskampf „laufenden“ ihren Blick auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens richten. Er ist das Beispiel des Glaubens, an dem sich die ermüdeten und abgekämpften Christen orientieren sollen. So wie das Volk Israel während der Wüstenwanderung sich des Nachts an einer Feuersäule und des Tags an der Wolke orientierte, so kann die christliche Gemeinde mit dem Blick auf Jesus zielsicher unterwegs sein.
Es sind also seelsorgerliche Gründe, dass der Verfasser des Hebräerbriefes seine Leser an die Zusammengehörigkeit der versuchten Christen mit dem versuchten Christus erinnert.
Der Predigttext für den Sonntag Lätare (2. März) steht im Buch des Propheten Jesaja, Kapitel 54, die Verse 7- 10
Ich habe dich einen kleinen Augenblick verlassen, aber mit großer Barmherzigkeit will ich sammeln. Ich habe mein Angesicht im Augenblick des Zorns ein wenig vor dir verborgen, aber mit ewiger Gnade ich mich deiner erbarmen, spricht der Herr, dein Erlöser.
Ich halte es wie zur Zeit Noahs, als ich schwor, dass die Wasser Noahs nicht mehr über die Erde gehen sollten. So habe ich geschworen, dass ich nicht mehr über dich zürnen und dich nicht mehr schelten will.
Denn es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen, aber meine Gnade soll nicht von dir weichen, und der Bund meines Friedens soll nicht hinfallen, spricht der Herr, dein Erbarmer.
Lätare = „Freuet euch“ mit Jerusalem! (Jesaja 66, 10); der vierte Sonntag in der Passionszeit.
Ein poetischer Text mit einer großen Sprachdichte. So reden die Psalmen des Alten Testamentes. Dieser Predigttext aus dem Buch des zweiten Jesaja, der zwischen 587 und 515 vor Christus entstanden sein dürfte, entfaltet in einer sprachlichen Schönheit und Dichtheit ohnegleichen das Verhältnis Gottes zu seinem Volk. Die persönliche Rede des Textes soll die Dimension der Heilszusage Gottes spürbar werden lassen. Sie schließt jeden Angehörigen des Volkes Gottes ein; denn nach den in den Kapiteln 40 – 55 vorkommenden theologischen Grundaussagen gehört, dass Gott der „König“ ist, dessen Herrschaft über die Welt von der Königsstadt Jerusalem ausgeht und in ihr sein Ziel hat. Der universale Gott ist der Gott der ganzen Welt. (Kapitel 54, 5)
So durchzieht das gesamte Kapitel 54 eine große Spannung. Das „Du“ unseres Textes entspricht dem gesamten Volk Israel, das in seinem Heilsort Jerusalem/Zion sich wieder finden soll. Auf der Ebene der Bilder dieses Kapitels wird die persönliche Zuwendung Gottes in einer „Liebeszene“ geschildert, in der Gott als Liebender voller Sehnsucht und Zärtlichkeit redet. Es ist wie die Liebesbeziehung zweier erwachsener Menschen, die viel miteinander erlebt haben und die viel einander schuldig geblieben sind bis in die Augenblicke des Zorns.
Aus den prophetischen Reden des Alten Testaments sind viele Szenen bekannt, in denen das Verhältnis des Volkes mit Gott in „Ehebeispielen“ beschrieben wird.
Diese Beschreibungen sind – wie die in unserem Text auch –immer durchlässig auf geschichtliche Erfahrungen. So wird hier die Noahtradition angesprochen, um auf die Besonderheit der Zeitwende hinzuweisen, die Israel gerade erfährt. Nach der Katastrophe des Exils 587 – 515 vor Christus ist jetzt ein neuer Anfang gegeben. So redet der Text auf zwei Ebenen. Er enthält Hochzeitsversprechen und spricht von der Erneuerung des Gottesverhältnisses. Die Großartigkeit der Sprache aber soll die Kleingläubigen und Müdegewordnen aus ihrer falschen Gotteserfahrung herausholen. Der Prophet wendet sich an Herz und Verstand seiner Zuhörer, damit sie die Perspektiven Gottes für sein Volk und das Leben jedes Einzelnen vernehmen.
Der Predigttext für den Sonntag Okuli (24. Februar) steht im 1. Buch der Könige, Kapitel 19, die Verse 1 – 13a
Und Ahab sagte Isebel alles, was Elia getan hatte und wie er alle Propheten Baals mit dem Schwert umgebracht hatte. Da sandte Isebel einen Boten zu Elia und ließ ihm sagen: Die Götter sollen mir dies und das tun, wenn ich nicht morgen um diese Zeit dir tue, wie du diesen getan hast! Da fürchtete er sich, machte sich auf und lief um sein Leben und kam nach Beerscheba in Juda und ließ seinen Diener dort. Er aber ging hin in die Wüste eine Tagesreise weit und kam und setzte sich unter einen Wacholder und wünschte sich zu sterben und sprach: Es ist genug, so nimm nun, Herr, meine Seele; ich bin nicht besser als meine Väter.
Und er legte sich hin und schlief unter dem Wacholder. Und siehe, ein Engel rührte ihn an und sprach zu ihm: Steh auf und iss! Und er sah sich um, und siehe, zu seinen Häupten lag ein geröstetes Brot und ein Krug mit Wasser. Und als er gegessen und getrunken hatte, legte er sich wieder schlafen. Und der Engel des Herrn kam zum zweiten Mal wieder und rührte ihn an und sprach: Steh auf und iss! Denn du hast einen weiten Weg vor dir. Und er stand auf und aß und trank und ging durch die Kraft der Speise vierzig Tage und vierzig Nächte bis zum Berg Gottes, dem Horeb.
Und er kam dort in eine Höhle und blieb dort über Nacht. Und siehe, das Wort des Herrn kam zu ihm: Was machst du hier, Elia? Er sprach: Ich habe geeifert für den Herrn, den Gott Zebaoth; denn Israel hat seinen Bund verlassen und deine Altäre zerbrochen und deine Propheten mit dem Schwert getötet und ich bin allein übrig geblieben, und sie trachten danach, dass sie mir mein Leben nehmen.
Der Herr sprach: Geh heraus und tritt hin auf den Berg vor den Herrn! Und siehe, der Herr wird vorübergehen. Und ein großer, starker Wind, der die Berge zerriss und die Felsen zerbrach, kam vor dem Herrn her; der Herr aber war nicht im Winde. Nach dem Wind aber kam ein Erdbeben. Und nach dem Erdbeben kam ein Feuer; aber der Herr war nicht im Feuer. Und nach dem Feuer kam ein stilles, sanftes Sausen. Als das Elia hörte, verhüllte er sein Antlitz mit seinem Mantel und ging hinaus und trat in den Eingang der Höhle.
Und siehe, da kam eine Stimme zu ihm und sprach: Was hast du hier zu tun?
Dieser Text ist auch die alttestamentliche Lesung des Sonntags Okuli: „Meine Augen“ sehen stets auf den Herrn. (Psalm 25, 15)
Die Lesungen des Sonntages bedenken das Leben derjenigen, die dieses mit Feuereifer auf Gott hin ausrichten oder sich in die Nachfolge Jesu begeben.
Im ersten Buch der Könige, Kapitel 17 – 19, 18; 21 und 2. Könige, 1 wird das Wirken des Propheten Elia geschildert. Sein Name Elia „Mein Gott ist Jahwe“ ist Programm. Die Bibel schildert ihn in seinem Auftreten und in seiner geschichtlichen Wirkung als feurigen Propheten.
Jesus Sirach, Kapitel 48, 1: Bis dass aufstand ein Prophet wie Feuer“. Dramatisch sind die Erzählungen, in denen Elia Feuer vom Himmel fallen lässt. Rettend handelt er, als er eine Witwe und ihren Sohn vor dem Verhungern bewahrt und das Kind wieder vom Tode erweckt.
Elia ist ein Wanderprophet ohne festen Wohnsitz, der im Nordreich der große Gegenspieler des König Ahab (870 – 851) und seiner Frau Isebel ist. (932 zerfällt der unter David und Salomo geeinigte Stämmebund in das aus den Stämmen Juda und Benjamin gebildete Juda mit dem Zentralheiligtum in Jerusalem und das aus den anderen Stämmen gebildete Nordreich mit dem Heiligtum in Samaria.)
Das Nordreich ist in der Regierungszeit des Ahab eingebunden in ein militärisches und politisches Bündnis mit den umliegenden Kleinstaaten. Diese Einbindung wird sichtbar in der Heirat des Ahab mit der Tochter des Königs von Sidon. Diese Heirat hatte erhebliche innenpolitische Konsequenzen, da Ahab für die Kultausübung der Königin einen Tempel für den Gott Baal bauen ließ.
Die Baalsverehrung ist in dem Bereich zwischen Ägypten und dem Zweistromland schon seit dem 3.Jahrtausend vor Christus nachweisbar. Die Bezeichnung Baal dürfte mit „Besitzer, Herr, Gatte“ zu übersetzen sein. Baal wurde als Wetter- und Vegetationsgott verehrt. Darstellungen zeigen ihn mit einem Blitzbündel in der Hand und einer Stierhörnermütze auf dem Kopf.
Die Bündnispolitik religiös verschieden geprägter Staaten dürfte auch zu einer gewissen Anerkennung der Göttervorstellungen geführt haben. Gegen diese „Religionspolitik“ des Ahab wendet sich Elia mit seinem Wirken. Weiter wendet er sich gegen die sozialen Missstände seiner Zeit, die davon geprägt waren, dass das Königshaus und die königlichen Beamten zum Nachteile der kleinbäuerlichen Familien ihre Vermögen vergrößerten.
Das 19. Kapitel, in dem der Predigttext steht, zeigt einen Elia, der nach seinem blutigen Sieg über die Baalspropheten (Kapitel 18) gescheitert ist. Ihm trachtet die Königin nach dem Leben. Er ist, so klagt Elia, der einzige Anhänger Jahwes. Diese schwierige Situation setzt sich nun in dem Text fort. In der Wüste droht er zu verhungern und zu verdursten. Seine Klage am Gottesberg wird zweimal mit Erscheinungen beantwortet, in denen keine Gottesbegegnung stattfindet.
So sind die zentralen und wichtigen Stellen des Textes die, in denen Gott Elia für seine Zukunft stärkt. Ein Engel Gottes bringt Essen und Trinken und in der unerwarteten Stille eröffnet sich für ihn die Erfahrung Gottes. Elia erfährt so die eine Korrektur seines Gottesbildes. Nach seinem Vorverständnis müsste Gott in den dramatischen Naturereignissen zu ihm reden. Elia muss nach dem erfolgreichen Feuerzauber auf dem Karmel (Kapitel 18) innerlich still werden, um neu auf Gott hören zu können.
Der Predigttext für den Sonntag Reminiscere (17. 2.) steht im Hebräerbrief, Kapitel 11, die Verse 8 – 10
Durch den Glauben wurde Abraham gehorsam, als er berufen wurde, in ein Land zu ziehen, das er erben sollte; und zog aus und wusste nicht, wo er hinkäme. Durch den Glauben ist er ein Fremdling gewesen in dem verheißenen Lande wie in einem fremden und wohnte in Zelten mit Isaak und Jakob, den Miterben derselben Verheißung. Denn er wartete auf die Stadt, die einen festen Grund hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist.
Der zweite Sonntag in der Passionszeit. „Gedenke, – reminiscere – Herr, an deine Barmherzigkeit und Güte, die von Ewigkeit her gewesen ist.“ So lautet der Kehrvers, der den Eingangspsalm umrahmt.
Bis zum Pfingstmontag werden fünf Predigttexte aus dem Hebräerbrief zu predigen sein. Es lohnt sich, den gesamten Brief einmal zu lesen.
Fremdartig und einzigartig erscheint er unter den neutestamentlichen Schriften. Der uns unbekannte Verfasser hat eine Gemeinde im Blick, die nach Kapitel 12, Vers 2 erschöpft und resigniert in ihrem Glauben ist. Die zweite bzw. dritte Generation der urchristlichen Zeit hat ihre Energie in den ersten Leidenserfahrungen aufgebraucht. Die Zukunft des christlichen Lebens wird mit dem Ausbleiben der Wiederkunft Jesu Christi immer undeutlicher.
Die Anfechtungen werden immer größer, da jeder getaufte Christ mit seinem Bekenntnis sich einem anderen „Kulturkreis“ anschließt, der zu einer Entfremdung seitens der nichtchristlichen Mitbürger und Verwandten führt. Dies ist die Alltagssituation in der jungen Kirche. Darauf geht der Verfasser ein, der seinen Brief an eine Gemeinde mit einer städtischen Kultur in Italien – vielleicht sogar in Rom – um das Jahr 70 herum schreibt.
Das 11. Kapitel hebt sich in jeder Hinsicht aus dem Kontext des letzten Teiles von Kapitel 10 und der nachfolgenden Kapitel 12 und folgende heraus. Sachlich-lehrhaft liefert es eine Glaubenslehre, die am Glaubenszeugnis der „Alten“ beispielhaft demonstriert wird.
Das in Kapitel 11 aufgenommene Thema „Glaube“ wird in Kapitel 10, 38f. vorgegeben.
Der Schreiber des Briefes will dieses Thema nicht lehrhaft theologisch abhandeln, sondern das Wesen des Glaubens darin begründen, dass die Adressaten seines Schreibens sich in ihrer Glaubensanfechtung ihres eigenen Glaubens vergewissern. So ist nach Vers 1 des 11. Kapitels „der Glaube eine Befestigung dessen, worauf man hofft; und ein Beweis für Dinge, die man nicht sieht.“
Diese Definition ist bemerkenswert: Der Glaube erstreckt sich – er hofft – in die Zukunft Gottes, die über menschliche Zeiten hinausgeht. Das „Erhoffte“ aber ist ein noch „Nichtsichtbares“, das aber für den Glaubenden schon bereit liegt.
Hier kommen zwei Denkrichtungen zusammen. Der Autor bedient sich philosophischer Terminologie auf dem Hintergrund jüdischer und christlicher Apokalyptik.
Jesus Christus ist nach Kapitel 1, Vers 3 der „Abdruck“ der Wirklichkeit Gottes. So ist der Glaube in der Hoffnung auf das Erhoffte Ausdruck der Wirklichkeit für den Glaubenden. Außerhalb des Glaubens gibt es keine Gewissheit. So kann die Unanschaulichkeit dessen, worauf sich der Glaube richtet und ausstreckt, nur durch den Glauben selbst bewältigt werden.
Die Verse 8 -10 gehören in den Zusammenhang der Verse 8- 22, in denen es um das Glaubenszeugnis der Patriarchen geht. Abraham wird in dieser Reihe eine besondere Stellung eingeräumt. Die außerordentliche Hochschätzung Abrahams ist im gesamten jüdischen wie auch frühchristlichen Bereich üblich.
Anknüpfend an die im 1. Buch Mose berichtete Abrahamserzählung wird hier hervorgehoben, dass er sich gehorsam auf den Ruf Gottes einlässt, obwohl das verheißene und erhoffte Erbe
noch gar nicht sichtbar ist.
Abweichend von der biblischen Abrahamserzählung ist sein Aufenthalt im versprochenen Land nur eine Durchgangsstation zu jener „Stadt“, die auch er noch erwartet.
Diese Stadt ist das „himmlische Jerusalem“, die Gott – auch den Patriarchen bereitet hat.
Hier wird noch einmal die Denkweise der jüdischen wie auch christlichen Apokalyptik spürbar. Die jetzige Welt ist fremd; die himmlische Welt wartet auf den Glaubenden. Dieser ist in der irdischen Welt auf das Jenseits, die kommende „Stadt“, das himmlische Jerusalem ausgerichtet und unterwegs.
Damit wird deutlich, mit welcher Absicht dieser biblische Text geschrieben worden ist.
Der Glaube der Briefadressaten soll sich auf dem vor ihnen liegenden Weg in standhaltender Treue bewähren.
Der Predigttext für den Sonntag Invokavit (10. Februar) steht im Jakobusbrief, Kapitel 1, die Verse 12- 18
Selig ist der Mann, der die Anfechtung erduldet; denn nachdem er bewährt ist, wird er die Krone des Lebens empfangen, die Gott verheißen hat denen, die ihn lieb haben.
Niemand sage, wenn er versucht wird, dass er von Gott versucht werde. Denn Gott kann nicht versucht werden zum Bösen, und er selbst versucht niemand. Sondern ein jeder, der versucht wird, wird von seinen eigenen Begierden gereizt und gelockt. Danach, wenn die Begierde empfangen hat, gebiert sie die Sünde; die Sünde, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod.
Irrt euch nicht, meine lieben Brüder. Alle gute und alle vollkommene Gabe kommt von oben herab, von dem Vater des Lichts, bei dem keine Veränderung ist noch Wechsel des Lichts und der Finsternis. Er hat uns geboren nach seinem Willen durch das Wort der Wahrheit, damit wir Erstlinge seiner Geschöpfe seien.
Am ersten Sonntag in der Passionszeit ein Predigttext aus dem Jakobusbrief. Diesen Brief muss man erst einmal im Neuen Testament finden. Vor dem Buch der Offenbarung, dem letzten Buch des Neuen Testamente steht der aus einem Kapitel bestehende Judasbrief, vor dem die fünf Kapitel des Jakobusbriefes stehen.
Liest man diese Kapitel durch, so fällt im Text des zweiten Kapitels auf, dass dort gegen die Theologie des Paulus Stellung bezogen wird. Der Verfasser steht außerhalb der theologischen Hauptlinien des neuen Testamentes, die mit den Namen Paulus/Johannes/Evangelien und Hebräerbrief gekennzeichnet sind.
Im Briefeingang stellt sich der Verfasser als der Herrenbruder Jakobus vor. Er ist das anerkannte Oberhaupt der aus dem Judentum kommenden Christen. (So in der Apostelgeschichte 12, 17 und 15, 13ff.; 21, 18ff und im Galaterbrief)
Im Markusevangelium Kapitel 6, Vers wird Jakobus an erster Stelle in der Brüderliste Jesu genannt. In der Jerusalemer Christengemeinde dürfte er wegen seiner verwandtschaftlichen Nähe zu Jesus, seinem Auferstehungszeugnis (1.Korinterher 15,7) und seiner persönlichen Lebensführung eine führende Stellung eingenommen haben. Auf dem in der Apostelgeschichte, Kapitel 15 berichteten Apostelkonzil (48/49 nach Christus) ist er einer der drei als „Säulen“ bezeichneten Gemeindeleiter, die als Vertreter der Judenchristen mit Paulus und Barnabas als den Vertretern der Heidenchristen deren gesetzesfreie Evangeliumsverkündigung aushandeln. Dabei werden die von Jakobus und den Judenchristen vertretenen Auflagen für die Heidenchristen (Verzicht auf Götzenopferfleisch, Unzucht, Verzehr von Ersticktem) von Paulus akzeptiert.
Der Brief ist an die „zwölf Stämme in der Diaspora“ gerichtet. Damit sind judenchristliche Gemeinden angesprochen, die sich außerhalb des Jerusalemer Bereiches gebildet haben und sich als das „endzeitliche – eschatologische“ Israel verstehen. Die Auseinandersetzung um die Theologie des Paulus, dessen Rechtfertigungslehre, ist in den jungen christlichen Gemeinden noch in vollem Gange. So dürfte der Brief um 60 nach Christus, also noch zu Lebzeiten des Paulus geschrieben, sich an zum christlichen Glauben bekehrte griechisch sprechende Juden wenden.
Mit einer Ermutigung zum freudigen und belastbaren Glauben beginnt der Text nach den beiden Einleitungsversen des ersten Kapitels. Dieser Glaube soll sich im Spannungsfeld von Glaube und Zweifel (5 – 8) und arm und reich vor Gott (9 – 11) entfalten.
Diese beiden Spannungsfelder werden in den folgenden Kapiteln des Briefes entfaltet.
Liest man so diesen Jakobusbrief, dann wird deutlich, dass es in diesem vor allem darum geht, vor allen „Werken“ einen lebendigen und tätigen Glauben wahrzunehmen.
Christen sind von Gott Beschenkte. Sie können von dem leben, was sie von Gott empfangen haben. Sie sollen aber aus dem geschenkten Leben etwas machen.
„Alle gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben“. (Vers 17) Der gesegnete Mensch ist der, der sich von Gott beschenken lässt. Die Zusage des geschenkten Lebens ist im Evangelium von Jesus Christus geschehen. In der Annahme dieses Geschenks erwächst Mut und Kraft zu richtigem Tun.
Der Predigttext für den Sonntag Estomihi (3. Februar) steht im Buch des Propheten Jesaja, Kapitel 58, die Verse 1- 9a
Rufe getrost, halte nicht an dich! Erhebe deine Stimme wie eine Posaune und verkündige meinem Volk seine Abtrünnigkeit und dem Hause Jakob seine Sünden! Sie suchen mich täglich und begehren meine Wege zu wissen, als wären sie ein Volk, das die Gerechtigkeit schon getan und das Recht seines Gottes nicht verlassen hätte. Sie fordern von mir Recht, sie begehren, dass Gott sich nahe. „Warum fasten wir und du siehst es nicht an? Warum kasteien wir unseren Leib und du willst´s nicht wissen?“
Siehe, an dem Tag, da ihr fastet, geht ihr doch euren Geschäften nach und bedrückt alle eure Arbeiter. Siehe, wenn ihr fastet, hadert und zankt ihr und schlagt mit gottloser Faust drein. Ihr sollt nicht so fasten, wie ihr jetzt tut, wenn eure Stimme in der Höhe gehört werden soll. Soll das ein Fasten sein, an dem ich gefallen habe, ein Tag, an dem man sich kasteit, wenn ein Mensch seinen Kopf hängen lässt wie Schilf und in Sack und Asche sich bettet? Wollt ihr das ein Fasten nennen und einen Tag, an dem der Herr Wohlgefallen hat?
Das aber ist ein Fasten, an dem ich Gefallen habe: Lass los, die du mit Unrecht gebunden hast, lass ledig, auf die du das Joch gelegt hast! Gib frei, die du bedrückst, reiß jedes Joch weg!
Brich dem Hungrigen dein Brot, und die im Elend ohne Obdach sind, führe ins Haus! Wenn du einen nackt siehst, so kleide ihn, und entzieh dich nicht deinem Fleisch und Blut! Dann wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte, und deine Heilung wird schnell voranschreiten, und deine Gerechtigkeit wird vor dir hergehen, und die Herrlichkeit des Herrn wird deinen Zug beschließen. Dann wirst du rufen und der Herr wird dir antworten. Wenn du schreist, wird er sagen: Siehe, hier bin ich.
Der lateinische Name des Sonntages „Estomihi“ sind die Anfangsworte des Psalmes 31 „Sei mir – esto mihi – ein starker Fels“. Der Mittwoch der kommenden Woche trägt den Namen
„Aschermittwoch“. Mit ihm beginnt die 40tägige Fasten- oder Passionszeit. Beide Bezeichnungen sind üblich, wobei mit der jeweiligen Bezeichnung auch der inhaltliche Schwerpunkt dieser vorösterlichen Zeit benannt wird. Im evangelischen Bereich wird vorwiegend von der Passionszeit gesprochen.
Seit dem 4. nachchristlichen Jahrhundert ist eine vierzigtägige Vorbereitungszeit in der Kirche üblich. Bei der Zählung spielen biblische Hintergründe eine besondere Rolle. 40 Tage dauert die Sintflut, hält sich Mose auf dem Berg Sinai auf, 40 Jahre wanderte das Volk Israel durch die Wüste und 40 Tage hält sich Jesus in der Wüste auf.
Diese Zahl ist also in erster Linie keine exakte Zeitangabe, sondern enthält eine symbolische Bedeutung. Es ist mit dieser Zeitangabe eine Zeit der Vorbereitung, der Buße und der Läuterung gemeint.
Zur Bußpraxis gehört auch das Fasten. In der außerchristlichen und jüdischen Welt – also vor mehr als zweitausend Jahren – war das Fasten aus medizinischen wie religiösen Gründen bekannt und in Übung. In Anlehnung an die jüdische Praxis beschränkten sich die Christen in der Fastenzeit auf eine – am Abend - eingenommene Mahlzeit am Tage. Weiter wurde in dieser Zeit auf die Einnahme von Fleisch und Wein, Milch, Butter, Käse und Eier verzichtet.
Bei dieser Aufzählung wird deutlich, dass es sich hier um Produkte handelt, die in der zweiten Winterhälfte in einer von der Landwirtschaft abhängigen Gesellschaft nicht in ausreichendem Maße zur Verfügung standen. Diese „Mangelverwaltung“ dürfte auch zu einer allgemein verbindlichen Fastenpraxis beigetragen haben. Die nicht selbst verbrauchten Lebensmittel konnten so zur Unterstützung und Lebenserhaltung der Armen genutzt werden.
Der geistliche Sinn dieser Fastenpraxis ist darin zu sehen, dass der Mensch in seinem Kampf gegen Versuchungen jeglicher Art gestärkt und damit auch geistlich „überlebensfähiger“ gemacht wurde.
So kann es nicht verwundern, dass in der frühen christlichen Kirche diese Fastenzeit auch als herausgehobene Vorbereitungszeit für die Taufbewerber galt. Sie nahmen – wie schon vorher – am Wortgottesdienst teil und wurden vor der Abendmahlsfeier mit Gebet und Handauflegung entlassen. An den Fastensonntagen aber wurden ihr Lebenswandel und ihre Glaubensfestigkeit einer intensiven Prüfung unterzogen. Sie erhielten den Text der Bibel, das Glaubensbekenntnis und des Vater unser. Abschließend erklärten sie am Karsamstag ihre Absage an die satanischen Mächte, um so sich Christus und seiner Macht zu überantworten. Am Ostermorgen fand mit der Taufe die Aufnahme in die Gemeinde statt, die die Taufbewerber intensiv in der Vorbereitungszeit begleitet hatte.
Wie kommt es, dass die 40tägige Fastenzeit an einem Mittwoch beginnt? Die Sonntage waren als „Auferstehungstage“ aus der Fastenzeit herausgenommen. So wurde – um die sechs Sonntage der Passionszeit auszugleichen – der Beginn dieser Zeit auf den Aschermittwoch gelegt.
Der Predigttext des Sonntages ist ein Abschnitt aus dem dritten Teil des Jesajabuches.
Es ist heute allgemein üblich, das mit seinen 66 Kapiteln umfangreichste Prophetenbuch des Alten Testamentes in drei aus unterschiedlichen Zeiten stammende Teile einzuteilen. Der erste Teil umfasst die Kapitel 1- 39. Dieser Teil des Buches ist dem Propheten Jesaja (ab 736 vor Christus) zuzuordnen. Der zweite Teil umfasst die Kapitel 40 – 55. Sein oder seine Verfasser sind Propheten aus der Zeit zwischen 587 bis 539; also der Zeit des babylonischen Exils. Der dritte Teil, die Kapitel 56 – 66 entstehen in der Zeit nach 537 vor Christus. Der oder die Verfasser sind ebenfalls namentlich nicht bekannt. Offensichtlich sind die verschiedenen Teile bei der Zusammenstellung der biblischen Text in der vorchristlichen Zeit unter dem programmatischen Namen „Jesaja – Jahwe rettet“ zusammengefasst worden.
Der zeitliche Hintergrund des Abschnittes 56 -66 ist gut zu erkennen. Die babylonische Herrschaft im Zweistromland (heute der Irak) wird 538 durch den Perserkönig Kyros beendet. Die persische Herrschaftsübernahme bedeutete eine Änderung der Politik über die besiegten Völker. Kyros beendet die babylonische Gefangenschaft der nach Babylon 587 deportierten Oberschicht. Sie durften nach Jerusalem zurückkehren und den Tempel wieder aufbauen. Im Esrabuch des Alten Testamentes, Kapitel 6, die Verse 3 -5 findet sich der Text der Anordnung des Kyros.
Die Botschaft des oder der Propheten dieser Zeit ist eine einzigartige und großartige Heilszusage. Viele Textabschnitte sind in unseren Bibeln herausgehoben, weil sie zentrale biblische Botschaften vermitteln. Offensichtlich hat die Rückkehr der Exilierten nach Jerusalem nicht die Wende zum großen Aufbruch und Neuanfang gebracht. Die Zeit zwischen 537 und 445, in die die Wirkungszeit des Verfassers dieses Teiles des Jesajabuches fällt, ist schwierig und ungeordnet.
Einen guten Einblick in die Verhältnisse dieser Zeit gibt das Buch des Propheten Maleachi (470 vor Christus).
Die zentrale Stelle unseres Textes sind die Verse 5 – 7: Wäre das ein Fasten, an dem ich Gefallen hätte…?
Die Antwort ist überraschend. An die Stelle des im Fasten auf Gott gerichteten Handelns wird nun ein auf den Menschen gerichtetes Handeln angemahnt. Der Prophet aber sagt nicht: anstelle des Fastens sollt ihr so handeln, sondern ihr sollt eine andere Form des Fastens wahrnehmen. Die Selbstbeschränkung und das Verzichten, die zum Fasten gehören, werden nun zu Taten des Helfens. Unter den verschiedenen Hilfen, die in den Versen 6 und 7 genannt werden, ist die des „Lösens von Fesseln“ am Auffälligsten. Hier wird die Erinnerung an die Zeit der gerade zu Ende gegangenen babylonischen Gefangenschaft erinnert. Die Hilfe zur Freiheit war Gottes Werk. So gilt es nun, dieses Handeln Gottes im eigenen Leben umzusetzen. Die Bräuche der Selbstkasteiung sind unwichtig geworden. Ein gewaltiger Schritt in der biblischen Verkündigung wird spürbar. Im Namen Gottes sind das menschliche Leben und seine Freiheit wichtiger als auf Gott gerichtete Kultriten.
Der Predigttext für den Sonntag Sexagesimä (60 Tage vor Ostern = 27. Januar) steht in der Apostelgeschichte des Lukas, Kapitel 16, die Verse 9 – 15
Und Paulus sah eine Erscheinung bei Nacht: Ein Mann aus Mazedonien stand da und bat ihn: Komm herüber nach Mazedonien und hilf uns! Als er aber die Erscheinung gesehen hatte, da suchten wir sogleich nach Mazedonien zu reisen, gewiss, dass uns Gott dahin berufen hatte, ihnen das Evangelium zu predigen.
Da fuhren wir von Troas ab und kamen geradewegs nach Samothrake, am nächsten Tag nach Neapolis und von da nach Philippi, das ist eine Stadt des ersten Bezirks von Mazedonien, eine römische Kolonie. Wir blieben aber einige Tage in dieser Stadt. Am Sabbattag gingen wir hinaus vor die Stadt an den Fluss, wo wir dachten, dass man zu beten pflegte, und wir setzten uns und redeten mit den Frauen, die dort zusammenkamen.
Und eine gottesfürchtige Frau mit Namen Lydia, eine Purpurhändlerin aus der Stadt Thyatira, hörte zu; der tat der Herr das Herz auf, sodass sie darauf Acht hatte, was von Paulus geredet wurde. Als sie aber mit ihrem Hause getauft war, bat sie uns und sprach: Wenn ihr anerkannt, dass ich an den Herrn glaube, so kommt in mein Haus und bleibt da. Und sie nötigte uns.
„Dein Wort ist meines Fußes Leuchte“ beschreibt der 105. Vers Psalmes 119 die Wirkung des Wortes Gottes. In der alttestamentliche Lesung dieses Sonntages aus dem Buch des Propheten Jesaja wird die Wirkung des Wortes Gottes mit dem „Regen“ und „Schnee“ verglichen, die den Samen wachsen lassen und damit das Brot zur Ernährung ermöglichen. (Jesaja 55,10).
Diesen Gedanken von der Wirkung des Wortes Gottes nimmt der Predigtabschnitt aus der Apostelgeschichte auf. Bei der Abgrenzung des Textes sind die vorausgehenden Verse 6 -8 des ersten Teiles des 16. Kapitels und die nachfolgenden Verse 16 – 40 des gleichen Kapitels unberücksichtigt geblieben.
Ab Kapitel 15, 35 bis zum Schluss der Apostelgeschichte ist diese eine Paulusgeschichte. Der erste Teil diese neutestamentlichen Buches 1,1 – 8,40 beschreibt die entscheidende Wende in der Geschichte des Gottesvolkes. In Jerusalem treten Juden auf, die an den Messias-Jesus glauben. Der auf zwölf Jünger ergänzte Kreis stellt das wieder errichtete Bundesvolk dar. Am Ende dieses Abschnittes werden von einem Mitglied der Jerusalemer Christengemeinde, Philippus, die verlorenen Juden – Samaritaner und Proselyten – in diese neue Gottesgemeinschaft geholt.
Im zweiten Abschnitt von 9, 1 – 15, 36 setzt sich die Erneuerung des Volkes Gottes in Jerusalem fort. Zuerst sind es die Juden - beispielhaft Paulus – und dann die Heiden, die in großen Mengen bekehrt werden. Am Ende des Abschnitts wird der Konflikt über den Status der „Heiden“ in der christlichen Gemeinde auf dem Apostelkonzil gelöst.
Der dritte Abschnitt beschreibt die paulinische Missionsarbeit um das ägäische Meer; abschließend demonstriert er seine Gesetzestreue in der Jerusalemer Urgemeinde mit einem Gelübde.
Der letzte Teil der Apostelgeschichte von 21, 27 – 28, 31 behandelt den römischen Prozess gegen Paulus und seine Auseinandersetzung mit seinen jüdischen Volksgenossen, die in Rom stattfindet.
Die gesamte Erzählung will das Wachsen des neuen Gottesvolkes der Christen von Jerusalem nach Rom deutlich machen. Die frühe kirchliche Überlieferung benennt den Arzt und Reisegefährten des Paulus, Lukas, als Verfasser der Apostelgeschichte und des Evangeliums. Ihn finden wir im Philemon-, dem Kolosser- und 2. Timtheusbrief.
Zu Beginn der Apostelgeschichte weist Lukas auf das Evangelium hin. Diese dürfte nach 70 nach Christus geschrieben sein, so dass die Apostelgeschichte in dem Zeitraum zwischen 80 und 90 nach Christus entstanden sein könnte. Die Leser dieses Werkes dürften judenchristliche und ehemalige der jüdischen Religion nahe stehende „Gottesfürchtige“ sein, denen Lukas zeigen will, dass sie das Gottesvolk, das wahre Israel sind, in dem auch Nichtjuden – also Heiden – Anteil am Heil Israels erhalten.
Der Predigtabschnitt beginnt mit der Beschreibung der Missionsarbeit in der Landschaft Galatien, dem Nordteil der römischen Provinz gleichen Namens. Von dort soll es in die Landschaft „Asia“ um Ephesus herum gehen. In beiden Bereichen wird die Verkündigung durch den „Geist Gottes“ verhindert. Damit soll deutlich werden, dass die Missionsarbeit allein durch Gottes Führung bestimmt ist.
Durch eine nächtliche Vision wird dem Paulus der Wille Gottes deutlich. Ein Mazedonier erscheint ihm als Repräsentant seines Volkes, dem nun das Evangelium zu verkündigen ist.
Mit den nun folgenden „wir“ wird deutlich, dass der Berichterstatter in Troas mit Paulus zusammentrifft. Die genaue Angabe der Reiseroute führt die kleine Gruppe in die mazedonische Stadt Philippi. Sie ist eine römische Kolonie, in der ehemalige römische Soldaten angesiedelt waren, denen die Rechtsordnung und die Vorrangstellung vor anderen Volksgruppen verliehen worden war. Die Gebetsstätte der kleinen jüdischen Gemeinde ist offensichtlich außerhalb des Ortes. Entsprechend der Absicht des Lukas geschieht die Verkündigung an die Juden, die Angehörigen des Volkes Gottes, das durch den Messias-Jesus wieder errichtet worden ist. Es sind nur Frauen, die Paulus und seine Begleiter antreffen. Dies könnte darauf hindeuten, dass es in dieser von ehemaligen römischen Soldaten besiedelten Stadt nur wenige Juden gibt. Demnach wären diese Frauen „Gottesfürchtige“, also Menschen, die eine innere Nähe zur jüdischen Religion pflegen.
Lydia, eine Purpurhändlerin, wird als einzige namentlich erwähnt. Sie scheint die Leitern dieser Gruppe zu sein. Die Predigt des Paulus geschieht, aber „der Herr schloss das Herz auf“. Das Wirken Gottes ist es, der Menschenherzen und Gedanken öffnet, so will es Lukas vermitteln.
Lydia und die Angehörigen ihrer Hausgemeinschaft werden getauft. Paulus und seine Begleiter nehmen auf Drängen dieser neuen christlichen Gemeinschaft unter ihnen Wohnung.
Christen dürfen nur unter Christen wohnen. Paulus und seine Begleiter nehmen nicht nur die Einladung an, sondern bestätigen den Glauben ihrer Gastgeber.
Die Besonderheit dieses neutestamentlichen Abschnittes wird heute darin gesehen, dass der christliche Glaube sich von Asien nach Europa ausbreitet. Diese Vorstellung dürfte für die Verfasserzeit keine Rolle gespielt haben, denn Mazedonien gehörte als römische Provinz zum römischen Reich, das sich diesseits und jenseits des ägäischen Meeres befand. Das „Wachsen des Wortes Gottes“ aber geschieht auch in einem von Männern dominierten Gemeinwesen. Die nachfolgenden nicht zu unserem Predigttext gehörenden Verse des Kapitels zeigen diesen Konflikt überdeutlich auf.
Der Predigttext für den Sonntag Septuagesimä – 70 Tage vor Ostern – (20.Januar) steht im Brief des Paulus an die Römer, Kapitel 9, die Verse 14- 24
Was sollen wir nun hierzu sagen? Ist denn Gott ungerecht? Das sei ferne!
Denn er spricht zu Mose (2.Mose 33, 19): Wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig; und wessen ich mich erbarme, dessen erbarme ich mich.“
So liegt es nun nicht an jemandes Wollen oder Laufen, sondern an Gottes Erbarmen.
Denn die Schrift sagt zum Pharao (2. Mose 9, 16): „Eben dazu habe ich dich erweckt, damit ich an dir meine Macht erweise und damit mein Name auf der ganzen Erde verkündigt werde.“
So erbarmt er sich nun, wessen er will, und verstockt, wen er will.
Nun sagst du zu mir: Warum beschuldigt er uns dann noch? Wer kann seinem Willen widerstehen? Ja, lieber Mensch, wer bist du denn, dass du mit Gott rechten willst? Spricht auch ein Werk zu seinem Meister: Warum machst du mich so? Hat nicht ein Töpfer Macht über den Ton, aus demselben Klumpen ein Gefäß zu ehrenvollem und ein anderes zu nicht ehrenvollem Gebrauch zu machen? Da Gott seinen Zorn erzeigen und seine Macht kundtun wollte, hat er mit großer Geduld ertragen die Gefäße des Zorns, die zum Verderben bestimmt waren, damit er den Reichtum seiner Herrlichkeit kundtue an den Gefäßen der Barmherzigkeit, die er zuvor bereitet hatte zur Herrlichkeit.
Dazu hat er uns berufen, nicht allein aus den Juden, sondern auch aus den Heiden.
70 Tage vor Ostern - im Ablauf des Kirchenjahres kommt die Passions- und Osterzeit schon in den Blick. In der gottesdienstlichen Liturgie verstummt das Halleluja nach der ersten Lesung, um erst wieder als Osterjubel zu ertönen.
Die beiden biblischen Lesungen dieses Sonntages nehmen die Frage nach dem Gerechtsein Gottes auf. Handelt Gott tatsächlich gerecht?
In den Kapiteln 9 – 11 seines Briefes wendet sich Paulus mit der zentralen Botschaft von der Gerechtigkeit Gottes an seine Volksgenossen. „Ich sage die Wahrheit in Christus, dass ich große Traurigkeit in meinem Herzen habe. Ich selber wünschte von Christus getrennt zu sein
für meine Brüder, die meine Stammverwandten sind nach dem Fleisch. (9 1ff. in Auswahl)“
In der Geschichte Jesu Christi hat nach Paulus der Gott gehandelt, der dem Volk Israel Verheißungen und Barmherzigkeit gezeigt hat. So sagt es Paulus in den dem Predigttext vorausgehenden Versen des Kapitels 9. Deutlich wird aber auch, dass die Besonderheit Israels als Volk Gottes nicht auf Grund einer bestimmten Abstammung oder wegen einer Volkszugehörigkeit besteht, sondern einzig durch das erwählende, verheißende und schöpferische Wort Gottes bestimmt ist. Darin wird die Freiheit Gottes sichtbar, dass er nicht nach menschlichen Maßstäben – in denen er in seinem Handeln als ungerecht oder irrational erfahren wird – handelt, indem Gottes Gerechtigkeit seine bedingungslosen Zuwendung ist.
Dieses reflektiert Paulus in den Versen 15 – 18 unseres Predigttextes. Gottes Handeln ist nicht an menschliche Bedingungen geknüpft. Der Pharao handelte (vergeblich) böse, weil er von Gott zu dieser Rolle ausersehen wurde, damit sein Volk seine liebevolle Zuwendung erfuhr.
Diese liebevolle Zuwendung „ damit er den Reichtum seiner Herrlichkeit kundtue an den Gefäßen der Barmherzigkeit“ ist Inhalt und Ausdruck der Gerechtigkeit Gottes.
Diese Zuwendung stiftet Gemeinschaft unter denen, die auf seine Liebe vertrauen. So wird der Schlussvers 24 zum Schlüsseltext dieses Predigtabschnittes.

Der Predigttext für den letzten Sonntag nach Epiphanias (13. Januar) steht im 2. Petrusbrief, Kapitel 1, die Verse 16 – 21
Denn wir sind nicht ausgeklügelten Fabeln gefolgt, als wir euch kundgetan haben die Kraft und das Kommen unseres Herrn Jesus Christus; sondern wir haben seine Herrlichkeit selber gesehen. Denn er empfing von Gott, dem Vater, Ehre und Preis durch eine Stimme, die zu ihm kam von der großen Herrlichkeit: Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe. Und diese Stimme haben wir gehört vom Himmel kommen, als wir mit ihm waren auf dem heiligen Berge.
Umso fester haben wir das prophetische Wort, und ihr tut gut daran, dass ihr darauf achtet als auf ein Licht, das da scheint an einem dunklen Ort, bis der Tag anbreche und der Morgenstern aufgehe in euren Herzen. Und das sollt ihr vor allem wissen, dass keine Weissagung in der Schrift eine Sache eigener Auslegung ist. Denn es ist noch nie eine Weissagung aus menschlichem Willen hervorgebracht worden, sondern getrieben von dem Heiligen Geist haben Menschen im Namen Gottes geredet.
Der kommende Sonntag wird als der letzte Sonntag nach Epiphanias bezeichnet. Eine Woche vorher war das Epiphaniasfest. In manchen Jahren können es bis zu sechs Epiphaniassonntage sein. Diese Verschiebungen hängen mit dem Termin des Osterfestes zusammen, dass seit dem Konzil von Nizea im Jahre 325 nach Christus immer am Sonntag nach dem ersten Vollmond im Frühling gefeiert wird. Das jüdische Passahfest war und ist bis heute nach dem Mondkalender so im Jahresfestkalender eingeordnet. Die Kreuzigung und der Tod Jesu geschahen vor dem jüdischen Passahfest; seine Auferstehung am ersten Tag der Woche. Aus ihm entstand der Auferstehungstag, den die Christen als ihren wöchentlichen Feiertag begingen: der christliche Sonntag ersetzte den jüdischen Sabbat.
Der letzte Sonntag nach Epiphanias wird im evangelischen Bereich immer als Fest der Verklärung Jesu begangen. Das Evangelium des Sonntages ist der Bericht über die Verklärung Jesu, der Parallelen zu den Berichten über die Taufe Jesu aufweist. (Matthäus 17, 1ff.)
Daran knüpft auch der Predigttext aus dem zweiten Petrusbrief, dem jüngsten neutestamentlichen Text an, dessen Entstehung auf die Zeit um 12o – 140 nach Christus zu datieren ist.
Erster und zweiter Petrusbrief gehören inhaltlich nicht zusammen. Sie stammen nach Stil und Situation nicht vom gleichen Verfasser. Die Benennung des Petrus als Verfasser sollen Alter und Zuverlässigkeit reklamieren.
Nach Kapitel 3, Vers 3 des zweiten Petrusbriefes sollen die „Spötter“ unschädlich gemacht werden, die die Parusie leugnen. Mit dem Begriff Parusie (zu deutsch: anwesend sein) wird das Kommen Jesu Christi am Ende der Geschichte als Herrscher und Weltenrichter bezeichnet.
In den drei Kapiteln des Briefes wird die aus dem Inhalt nicht erkennbare Gemeinde gegen die Übernahme von falschen Lehren und Lehrern immunisiert. Dazu gehört die petrinische Verfasserangabe. Er ist Augen- und Ohrenzeuge des Lebens Jesu. Der Brief ist das vor seinem Tode entstandene geistliche Testament.
Im Kapitel 2, 1 – 22 werden die Gegner massiv verunglimpft. Sie werden dazu angehalten, sich einer von kirchlicher Autorität gestützten Bibelauslegung zu befleißigen.
Die Vorwürfe an die Gegner sind sehr allgemein als Ausschweifungen, Lästerung der Engelmächte und Leugnung der Wiederkunft (Parusie) Christi formuliert. Inwieweit hier eine für die Zeit des zweiten nachchristlichen Jahrhunderts geistlich-philosophische Haltung (Gnosis) angesprochen wird, kann dem Brieftext nicht entnommen werden.
Der unbekannte Verfasser des Briefes hält den Spöttern über das Ausbleiben der Wiederkunft Christi entgegen, dass diese Erwartung nicht auf ersonnenen „Fabeln“ gründet, sondern auf dem apostolischen Zeugnis. Er, der Verfasser, spricht nun in der Autorität des Petrus. Das göttliche Wort: „Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe“ wird zur Vorschau des Kommenden. Dieses Wort soll im Dunkeln leuchten bis der „Morgenstern aufgeht in euren Herzen“. (Vers 19)
Damit wird die grundsätzliche Spannung deutlich, in der die Wiederkunftsthematik steht. Es ist die Dynamik von Ankunft und Wiederkunft, in der die christliche Gemeinde lebt. Im gottesdienstlichen Lob, in der Erinnerung an Christus und in der Anrufung des Geistes öffnet die christliche Gemeinde die Geschichte Gottes in Jesus Christus „bis er kommt“.
Der letzte Sonntag nach Epiphanias beschließt den Weihnachtsfestkreis, in dem von Anfang bis Ende der Stern leuchtet. In der Reformationszeit wird dieses in der Antike mit anderem Inhalt versehene Motiv auf Christus gedeutet. War der Morgenstern in der Minnelyrik des Mittelalters eine Anrede an den Geliebten, singt nun die Gemeinde ein Lied an den „geliebten Bräutigam“. So findet sich eine Reihe von „Morgensternliedern“ in unserem Gesangbuch, die an diesem Sonntag auch zu den inhaltlichen Aussagen der singenden Gemeinde werden können.
Der Predigttext für den 1. Sonntag nach Weihnachten (6. Januar 2008) steht im 2. Brief des Paulus an die Korinther, Kapitel 4, die Verse 3 – 6.
Ist nun aber unser Evangelium verdeckt, so ist´s denen verdeckt, die verloren werden, den Ungläubigen, denen der Gott dieser Welt den Sinn verblendet hat, dass sie nicht sehen das helle Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit Christi, welcher ist das Ebenbild Gottes.
Denn wir predigen nicht uns selbst, sondern Jesus Christus, dass er der Herr ist, wir aber eure Knechte um Jesu willen. Denn Gott, der sprach: Licht soll aus der Finsternis hervorleuchten, der hat einen hellen Schein in unsre Herzen gegeben, dass durch uns entstünde die Erleuchtung zur Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes in dem Angesicht Jesu Christi.
In diesem Jahr fällt der Epiphaniastag (Erscheinung des Herrn) oder Dreikönigstag auf den ersten Sonntag nach dem Weihnachtsfest.
In den orthodoxen Kirchen Ost- und Südosteuropas wird dieser Tag als das ältere Geburtsfest Christi gefeiert. In den westlichen Kirchen wurde – nachdem das Weihnachtsfest auf den 25. Dezember verlegt war – der 6. Januar in Verbindung mit der bei Matthäus stehenden Erzählung der Weisen aus dem Morgenland und der Taufe Jesu gefeiert. In beiden neutestamentlichen Erzählungen „erscheinen“ himmlische Bekundungen zugunsten des Gottessohnes.
Die Ursprünge des Erscheinungsfestes am 6. Januar liegen in Ägypten. Dort knüpfte eine christlich-gnostische Sekte im 3. nachchristlichen Jahrhundert an den Brauch an, in der Nacht vom 5. auf den 6. Januar die Geburt des Sonnengottes Aion aus der Jungfrau Kore zu feiern. Am Tage ging man zum Nil, um heilbringendes Wasser zu schöpfen. Es ist deutlich, dass hier Sonnen- und Nilkult eine Verbindung eingingen. Zu Beginn des 4. nachchristlichen Jahrhunderts wird in Alexandria der 6. Januar als christliches Fest gefeiert, der sowohl die Geburt als auch die Taufe Jesu zum Thema hat. (Die weitere Entwicklung s. oben)
Der Predigttext für diesen Sonntag ist ein Abschnitt aus dem zweiten Korintherbrief. Beide Briefe stellen vom Briefumfang die Hälfte der Paulus zugeschriebenen Brieftexte des Neuen Testamentes dar. Die Korrespondenz des Paulus mit dieser – von ihm während seines Aufenthaltes zwischen 49 und 52 nach Christus gegründeten (Apostelgeschichte 18, 1- 18) – Gemeinde dürfte noch umfangreicher gewesen sein. Diese Gemeinde setzte sich mehrheitlich aus Heiden zusammen, zu denen ehemalige Juden und Anhänger der jüdischen Gemeinde kamen. Den beiden Briefen ist zu entnehmen, dass Angehörige aller sozialen Schichten dieser Gemeinde angehören, was ebenso zu erheblichen Spannungen führt, wie die ursprünglichen religiösen Erfahrungen und Vorstellungen. Hinzu kommt der Einfluss anderer christlicher Verkündigungs- und Lebensformen, die mit der paulinischen Theologie konkurrieren. Hier dürften die Spannungen eine besondere Rolle spielen, in die Paulus durch die Verkündigung eines gesetzesfreien Evangeliums mit einem großen Teil des Judenchristentums geraten war. (siehe Galaterbrief 2, 11 – 17)
Der zweite Korintherbrief hat den Auslegern zu allen Zeiten sehr viel Mühe gemacht, da die Vielzahl der Konflikte für Paulus und seine Mitarbeiter in diesem Brief zu unterschiedlichsten Themen führen, die ihn nicht als einheitliches Ganzes erscheinen lassen. So werden theologische Themen mit Nachrichten, Reiseplänen, Planungen und Reflexionen über die Beziehungen zwischen Paulus und der Gemeinde miteinander verwoben.
Der Brief könnte – wenn er als Einheit betrachtet wird – im Herbst des Jahres 55 nach Christus geschrieben worden sein.
Der Predigtabschnitt für diesen Sonntag gehört in den thematischen Zusammenhang des
Briefabschnittes 2, 15 – 7, 16. Hier geht es Paulus darum, seine Existenz als Apostel und der Kirche als Schöpfungswerk Gottes darzustellen, dessen Entsprechung sich in der Auferweckung Jesu Christi findet. Auf dieser von allen Mitchristen akzeptierten Basis solle man sich gegenseitig achten und miteinander reden.
Der letzte Vers des Predigttextes, der Vers 6, ist die inhaltliche wichtigste Aussage dieses Abschnittes. Ihn besonders zu beachten verhindert auch, sich durch den Anfang des Textes in eine gedankliche Konfrontation mit Andersgläubigen hinein zwingen zu lassen.
In diesem Vers 6 finden wir in konzentrierter Form Grundüberzeugungen des Paulus.
Der jüdische Christ Paulus bringt die Gemeinsamkeit des in der jüdischen Bibel (unserem Alten Testament) bezeugten Gottes mit dem Gott zusammen, den er in der Begegnung mit dem auferstandenen Christus erfahren hat.
Nach 1. Mose1, 3 ist es Gott, der aus der Finsternis das Licht leuchten lässt. Die Finsternis hat keinen Anteil an dem Licht. Gott allein ist der souveräne Schöpfer des Lichts.
Im dem dritten Kapitel nimmt der Jude Paulus die Vorstellung von der „Kabod Jahwes“, der Herrlichkeit Gottes auf, deren unaussprechliche Herrlichkeit so gewaltig ist, dass Mose sich mit einer Decke verhüllen musste.
Diesen Gott, der seine Herrlichkeit so leuchten ließ, der hat sich in Kreuz und Auferstehung Jesu Christi auf neue Weise erkennbar gemacht.
Das Wort „Herz“ spielt in diesem Vers und in dem gesamten Brief eine grundlegende Rolle,
Es ist der Ort, in den Gott seinen Geist den von Kreuz und Auferstehung Angesprochenen gibt, damit sie in der Gemeinschaft mit ihm und Christus leben.
Wieder hat Gott gehandelt. Aus dem Nichts hat er die „Herzen“ der Menschen erleuchtet.
Diese schöpferische Erleuchtung führt zur Erleuchtung des Denkens, ist also Aufklärung.
„Mir ist ein Licht aufgegangen“.
Für Paulus ist dieser Vorgang ein kreativer Schöpfungsakt Gottes. Es ist das Leuchten des Heiligen Geistes in uns.
Der Predigttext für den ersten Sonntag nach Weihnachten (30. Dezember) steht bei dem Propheten Jesaja, Kapitel 49, die Verse 13 – 16
Jauchzet, ihr Himmel; freue dich, Erde! Lobet, ihr Berge, mit Jauchzen!
Denn der Herr hat sein Volk getröstet und erbarmt sich seiner Elenden.
Zion aber sprach: Der Herr hat mich verlassen, der Herr hat meiner vergessen.
Kann auch eine Frau ihr Kindlein vergessen, dass sie sich nicht erbarme über den Sohn ihres Leibes? Und ob sie seiner vergäße, so will ich doch deiner nicht vergessen.
Siehe, in die Hände habe ich dich gezeichnet; deine Mauern sind immerdar vor mir.
Ein weiterer Predigttext aus dem zweiten Teil des Prophetenbuches, das den
Namen des Jesaja trägt. Es lohnt sich die Kapitel 40 – 55 einmal in ihrem
Zusammenhang zu lesen, um die Schönheit der Sprache und die inhaltliche
Kraft dieses unbekannten Propheten aus dem Ende der babylonischen
Gefangenschaft eines Teiles des jüdischen Volkes wahrzunehmen.
Im Vers 14 wird das große Thema der 587 vor Christus aus Jerusalem und
seiner Umgebung weggeführten Angehörigen der Oberschicht deutlich. Sie
meinen, von Gott verlassen zu sein.
Diese Behauptung aus dem Vers 14 findet sich inhaltlich wieder in den
Versen 20 und 24 dieses Kapitels. Sie gliedern die große Komposition 49, 14
- 26 der Heilsverkündigung des Propheten. Ist es Vers 14 eine Anklage
Gottes, so ist es Vers 29 eine Ich-Klage und in Vers 24 eine Feind-Klage.
Die geistige und geistliche Auseinandersetzung mit der Wegführung muss
verarbeitet werden. Der Prophet entlarvt mit seiner Heilsbotschaft die Klage
der im Exil lebenden Volks- und Glaubensgenossen als rückwärts gewandte
Frömmigkeit.
Mit dem in Vers 13 stehenden Loblied beginnt der Predigttext. Diese
Loblieder begleiten die Verkündigung dieses Propheten. (Ähnliches findet
sich in den Liedern Paul Gerhardts, der in und nach der Zeit des 30jährigen
Krieges Lob- und Trostlieder dichtet.)
Die Schönheit der Schöpfung singt in ihrer Großartigkeit und Majestät das
Lob Gottes.
Die Sterne am Himmel (Vers 13) und das Kind im Schoß der Mutter (Vers 16)
lassen den Blick der in Klage und Selbstzweifel im Exil Lebenden auf den
Schöpfergott lenken, dessen Treue nicht zerbrechen kann.
Der Predigttext für den vierten Adventssonntags (23. Dezember) steht im Buch des Propheten Jesaja, Kapitel 53, die Verse 7 – 10
Wie lieblich sind auf den Bergen die Füße der Freudenboten, die da Frieden verkündigen, Gutes predigen, Heil verkündigen, die da sagen zu Zion: Dein Gott ist König!
Deine Wächter rufen mit lauter Stimme und rühmen miteinander;
denn alle Augen werden es sehen, wenn der Herr nach Zion zurückkehrt.
Seid fröhlich und rühmt miteinander, ihr Trümmer Jerusalems;
denn der Herr hat sein Volk getröstet und Jerusalem erlöst.
Der Herr hat offenbart seinen heiligen Arm vor den Augen aller Völker,
dass aller Welt Enden sehen das Heil unses Gottes.
Ein Predigttext, den man sich gesungen vorstellen muss. Die gesprochene Form kann nur unvollständig den strahlenden Jubel zum Ausdruck bringen, der wiedergegeben werden soll. Ein wahrlich schöner Text für den vierten Adventssonntag, der in diesem Jahr ein Tag vor dem Heiligen Abend gefeiert wird.
Ein Predigttext aus dem Alten Testament: dem Buch des Propheten Jesaja. Unstrittig ist heute, dass dieses umfangreichste Prophetenbuch aus drei Teilen besteht, die aus zeitlich unterschiedlichen Zeiten stammen und unter dem programmatischen Namen des Jesaja (Jahwe rettet) zusammengefasst worden sind. Die Kapitel 40 – 55 des Prophetenbuches sind ein eigenes Buch. Es enthält die Prophetie eines während des babylonischen Exils unter den Exilierten wirkenden Propheten. Dieser namenlose Prophet ist von daher nicht in Verbindung zu sehen mit dem im achten vorchristlichen Jahrhundert wirkenden Propheten Jesaja, dem die Kapitel 1 – 39 zuzuschreiben sind.
Die Zeit des „Deuterojesaja“ ist exakt zu bestimmen. Das babylonische Reich, in dessen Zeit das jüdische Exil – die größte Katastrophe neben der im 20. Jahrhundert geschehenen Vernichtung des jüdischen Volkes – geschieht, zerfällt 539 vor Christus. 550 vor Christus beginnt der Feldzug des persischen Königs Kyros, der das Ende der Großmacht Babylon herbeiführt. In den Aussagen des „zweiten Jesaja“ spiegeln sich diese gewaltigen Bewegungen. Er sieht in ihnen
das großartige Geschichtswirken Gottes.
Die Besonderheit der Prophetie dieses unbekannten Jesaja besteht darin, dass er in dieser besonderen geschichtlichen Situation den Auftrag sah, der von Jerusalem weggeführten Oberschicht das Heil Gottes zu verkünden. Damit knüpfte er an die Gerichtspredigt der vorexilischen Zeit an. Das dort angekündigte Gericht war eingetreten. Jerusalem war den Feinden zugefallen. Die Wegführung aus dem von Gott verheißenen Land und dem Tempel galt es als Strafe Gottes anzunehmen. Nun aber war in die neue geschichtliche Stunde das Heilswort Gottes zu sagen.
Die Mitte dieser Botschaft hieß nun: Fürchte dich nicht. Es ist die Antwort auf die Klage der Menschen, die in der Ferne von gelobtem Land und Tempel nach der Zukunft ihres Glaubens und Gottes fragen.
Diese Heilsverkündigung des zweiten Jesajabuches ist im Alten Testament einzigartig. Im Neuen Testament finden sich vielfältige Hinweise auf dieses Buch des Alten Testamentes und seine Theologie.
Die Heilzusage beschreibt ein geschehenes Ereignis: „Predigt Jerusalem, dass ihre Knechtschaft ein Ende hat“. (40, 2) Die Botschaft des Propheten ist eine Freudenbotschaft und sie gilt jedem Einzelnen.
Unser Predigttext ist eine Antwort auf ein großes Gedicht, das sich in den Versen 51, 9 – 52, 3 findet. Der Klage Israels wird ein Ende gesetzt, nun folgt großer Jubel. Der Prophet wird zum Dichter, indem er die Ankunft des Siegerboten darstellt. Gott ist König. Neben dem Bild des Hirten ist das des Königs ein uraltes Gottesprädikat, die beide in der Verkündigung des Alten Testaments übernommen werden.
Der göttliche König besiegt seine Feinde und zieht triumphierend in seine Stadt ein. Nach der Thronbesteigung wird er jubelnd gefeiert. In den Gottesdiensten Israels zeigt sich dieser Königsjubel in den Psalmen 93 – 99.
Für den zweiten Jesaja bedeutet dieses Königsein Gottes aber nicht ein kultisches Geschehen, sondern ist Ausdruck seines erbarmenden Handelns.
„Alle Augen werden es sehen, wenn der Herr nach Zion zurückkehrt.“ (52, 7)
Der Advent, die Ankunft Gottes geschieht.
Der Predigttext für den dritten Adventssonntag (16. Dezember) steht im Buch der Offenbarung des Johannes, Kapitel 3, die Verse 1- 6
Und dem Engel der Gemeinde in Sardes schreibe: Das sagt, der die sieben Geister Gottes hat und die sieben Sterne: ich kenne deine Werke. Du hast den Namen, dass du lebst, und bist tot.
Werde wach und stärke das andre, das sterben will, denn ich habe deine Werke nicht als vollkommen befunden vor meinem Gott. So denke nun daran, wie du empfangen und gehört hast, und halte es fest und tue Buße! Wenn du aber nicht wachen wirst, werde ich kommen wie ein Dieb und du wirst nicht wissen, zu welcher Stunde ich über dich kommen werde. Aber du hast einige in Sardes, die ihre Kleider nicht besudelt haben; die werden mit mir einhergehen
in weißen Kleidern, denn sie sind´s wert.
Wer überwindet, der soll mit weißen Kleidern angetan werden, und ich werde seinen Namen nicht austilgen aus dem Buch des Lebens, und ich will seinen Namen bekennen vor meinem Vater und vor seinen Engeln. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt.
Der Predigttext des dritten Adventssonntages steht ebenfalls wie der des zweiten Adventssonntages im Buch der Offenbarung; ja die beiden Texte entstammen dem gleichen Kapitel dieses Buches und schließen aneinander an.
So sind die Bemerkungen zum Buch der Offenbarung nicht zu wiederholen, sondern können in den Anmerkungen zum Text des vorigen Sonntages nachgelesen werden.
Zu den Besonderheiten der apokalyptischen Denkweise, die das letzte Buch der Bibel bestimmt, gehört eine bestimmte Bedeutung der Zahlen. Am häufigsten wird die Zahl sieben genannt. Entsprechend der damaligen Vorstellung, die von sieben Gestirnen im Weltall ausging und diesen Gestirnen nach der babylonischen Gestirnsreligion Göttlichkeit zusprach, galt die Zahl 7 als diejenige, die das Weltall umgreift.
In der Apokalyptik wird mit dieser Zahl die Vollkommenheit des göttlichen Waltens ausgesprochen. Dementsprechend wird die halbe Sieben, also die Dreieinhalb benutzt, um eine begrenzte kurze Zeit anzugeben. Weiter wird die Vierzahl in Verbindung mit den vier großen Sternbildern gesehen, die das Himmelsgebäude tragen. Die Zwölfzahl umfasste neben den 12 Monaten des Jahreskreislaufes die zwölf Sternbilder, die im nördlichen bzw. südlichen Himmelskreis wahrzunehmen sind. In Babylon wurde diesen Sternbildern göttliche Verehrung zuteil.
Die jüdische Apokalyptik übernahm diese Zahlen. Die Gestirne aber wurden nicht mehr verehrt, sondern als Geschöpfe Gottes gesehen.
Die Stadt Sardes, an deren christliche Gemeinde das fünfte Sendschreiben geht, besaß im ersten Jahrhundert nach Christus kaum noch Bedeutung. Der Schreiber lässt die Gemeinde durch Christus tadeln, denn sie ist nur noch dem Namen nach lebendig. Die scharfe Drohung soll sie wachrütteln, denn die schwere Zeit der Versuchung liegt noch vor ihr. Ihre Buße soll darin bestehen, dass sie umkehrt und zu den ermutigenden Anfängen ihres Christseins zurückfindet.
Geschieht dies nicht, werden sie von der plötzlichen Ankunft Christi überrascht, der dann als Richter erscheint.
Die wenigen, die nach diesem Text ihre weißen Kleider nicht befleckt haben, dürften sich geschlechtlichen Ausschweifungen entzogen haben. Sie sollen als Lohn in die Gemeinschaft mit dem erhöhten Christus aufgenommen werden. Das in unserem Text beschriebene weiße Gewand wird immer im Zusammenhang mit himmlischen Erscheinungen genannt und nach dem Gericht den Seligen verliehen.
Deren Namen werden im „Buch des Lebens“ erscheinen. Diese Vorstellung entsprach dem damaligen Brauch, dass jeder Bürgerrechte besaß, der in das Buch einer Stadt eingeschrieben war. Im Buch des Lebens zu stehen bedeutete also, das himmlische Bürgerrecht zu besitzen und im Gericht bewahrt zu bleiben.
Der Predigttext für den zweiten Adventssonntag (9. Dezember) steht in der Offenbarung des Johannes, Kapitel 3, die Verse 7 – 13
Und dem Engel der Gemeinde in Philadelphia schreibe: Das sagt der Heilige, der Wahrhaftige, der hat den Schlüssel Davids, der auftut, und niemand schließt zu, der zuschließt, und niemand tut auf. Ich kenne deine Werke. Siehe, ich habe vor eine Tür aufgetan und niemand kann sie zuschließen; denn du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt und hast meinen Namen nicht verleugnet. Siehe, ich werde schicken einige aus der Synagoge des Satans, die sagen, sie seien Juden und sind´s nicht, sondern lügen; siehe ich will sie dazu bringen, dass sie kommen sollen und zu deinen Füßen niederfallen und erkennen, dass ich dich geliebt habe. Weil du mein Wort von der Geduld bewahrt hast, will auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die kommen wird über den ganzen Weltkreis, zu versuchen, die auf Erden wohnen. Siehe, ich komme bald; halte, was du hast, dass niemand deine Krone nehme.
Wer überwindet, den will ich machen zum Pfeiler in dem Tempel meines Gottes, und er soll nicht mehr hinausgehen, und ich will auf ihn schreiben den Namen meines Gottes und den Namen des neuen Jerusalem, der Stadt meines Gottes, die vom Himmel herniederkommt von meinem Gott, und meinen Namen, den neuen. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt.
Das letzte Buch des Neuen Testamentes, die Offenbarung des Johannes, ist in seinem Inhalt einzigartig. In ihm wird der Ablauf der Zeit von der Auferstehung und Erhöhung Christi bis zu seiner Wiederkunft und der Errichtung seiner Weltherrschaft beschrieben.
In den frommen Kreisen des Judentums war schon die Erwartung vom nahen Weltende und dem Anbruch der Welt Gottes lebendig.
Die jüdische Apokalyptik ist unter Aufnahme dualistischer Vorstellungen, die aus dem Iran kommen, gebildet worden. Diese Welt steht unter dem Regiment satanischer Mächte. In der letzten Zeit dieser Welt brechen schreckliche Ereignisse herein: Krieg, Teuerung, Krankheiten, Fruchtlosigkeit der Erde und der Frauen und die Ordnung der kosmischen Mächte gerät durcheinander. Damit kündigt sich das Ende dieser Weltzeit an. In der größten Not greift Gott ein, der nach einem festgelegten Plan die Toten aus den Gräbern auferstehen lässt und die Menschen vor seinen Richterstuhl versammelt. Auf diesem Richterstuhl sitzen Gott und der Messias/Christus, deren Urteilsspruch unwiderruflich über ewiges Leben oder ewige Verdammnis entscheidet. Danach folgt der alten die neue Welt, in der die von Gott berufenen Seligen mit ihm wohnen werden.
Der Apokalyptiker erfährt sein Wissen durch geheime Offenbarungen in Form von Träumen, ekstatischen Entrückungen und Visionen.
Im Alten Testament ist das aus dem zweiten Jahrhundert vor Christus entstandene Buch Daniel das älteste apokalyptische Buch.
Der Verfasser der Offenbarung nennt sich Johannes. Er ist offensichtlich eine Persönlichkeit von großer Autorität gewesen. Schon im zweiten nachchristlichen Jahrhundert wird festgestellt, dass der Evangelist Johannes nicht als Verfasser der Offenbarung infrage kommen darf, da beide Bücher in Text und Inhalt weit auseinander liegen. Der Verfasser der Offenbarung lässt an keiner Stelle erkennen, dass er ein Augenzeuge und Apostel Jesu gewesen ist. Seine Sprache ist mit biblischen Wendungen durchzogen, während im Evangelium nur selten ein biblisches Zitat zu finden ist. Nach der Theologie des Evangeliums ist der, der glaubt, schon dem Gericht entzogen, während in der Offenbarung eine Reihe endzeitlicher Ereignisse abrollen muss, bis das Gericht eintritt.
So wird man sagen können, dass der Verfasser ein „frühchristlicher Prophet“ gewesen ist, der in den Gemeinden Kleinasiens (heutige Türkei) mit großer Vollmacht gepredigt hat. Seine starke Verwurzlung im jüdisch-christlichen Umfeld ist deutlich. Zu vermuten ist, dass er mit dem in der frühen Christenheit bekannten Presbyter Johannes identisch ist, dessen Grab in Ephesus neben dem des Evangelisten Johannes gezeigt wurde.
Die Zeit der Abfassung des Buches der Offenbarung dürfte gegen Ende oder unmittelbar nach der Regierungszeit des römischen Kaiser Domitian (81 – 96 nach Christus) geschehen sein. Domitian fordert als erster römischer Kaiser von seinen Untertanen göttliche Verehrung. So geschehen Leiden und tödliche Konflikte für die christlichen Gemeinden, denen Johannes eine Botschaft des Trostes und der Mahnung sendet.
Unser Predigttext ist ein Teil der sieben Sendschreiben (2, 1 – 3,20). So ist ja das gesamte Buch eingeleitet: ein Brief an die sieben Gemeinden in Kleinasien (1, 4-8) Der Verfasser knüpft an die briefliche Form an, in der im Alten Testament die prophetische Botschaft vermittelt wird. Wie der Prophet vermittelt der „Seher“ das Wort Gottes, das ihm vermittelt wird. So findet sich bei dem Propheten Amos eine siebenfache Predigt. (Amos 1 und 2)
Alle Sendschreiben sind in gleicher Weise aufgebaut: Vorstellung des Redenden, Lob der Gemeinde; Tadel der Gemeinde (fehlt in unserem Text), Bußmahnung und Gericht. Der Schluss enthält eine Aufforderung zum Durchhalten bis zum Sieg.
Die sieben in der Offenbarung genannten Gemeinden stellen wegen der Bedeutung der Siebenzahl eine Auswahl dar. Die Städte aber lagen in der römischen Provinz Asia alle an der der großen Römerstraße, sie waren alle Gerichtsplätze und Orte staatlicher Behörden, in denen in besonderer Weise der Kaiserkult gepflegt werden musste und es deswegen zu schweren Konflikten der christlichen Gemeinden mit den römischen Behörden kommen musste.
In der Stadt Philadelphia (nach ihrem Gründer Attalos II. Philadelphos von Pergamon 159 – 138 vor Christus benannt) lebt eine kleine christliche Gemeinde. Sie erfährt in dem Sendschreiben nur Lob. Christus spricht zu ihr in göttlicher Hoheit, denn er hält den Schlüssel Davids in der Hand. Das Bild vom endzeitlichen David, der der Gemeinde die Tür öffnet, weist auf den Christus hin, der den Eingang in die endzeitliche Herrlichkeit erschließt.
In dem gut bekannten Weihnachtslied „Lobt Gott ihr Christen alle gleich“ heißt es so:
„Heut schließt er wieder auf die Tür zum schönen Paradeis; der Cherub steht nicht mehr dafür. Gott sei Lob Ehr und Preis.
Der Predigttext für den 1. Adventessonntag (2. Dezember) steht im Hebräerbrief, Kapitel 10, die Verse (19 – 22) 23 – 25
Weil wir denn nun, liebe Brüder, durch das Blut Jesu die Freiheit haben zum Eingang in das Heiligtum, den er uns aufgetan hat als neuen und lebendigen Weg durch den Vorhang, das ist: durch das Opfer seines Leibes, und haben einen Hohenpriester über das Gesetz Gottes,
so lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen in vollkommenem Glauben, besprengt in unsern Herzen und los von dem bösen Gewissen und gewaschen am Leib mit reinem Wasser.
Lasst uns festhalten an dem Bekenntnis der Hoffung und nicht wanken; denn er ist treu, der sie verheißen hat; und
lasst und aufeinander Acht haben und uns anreizen zur Liebe und zu guten Werken und nicht verlassen unsre Versammlungen, wie einige zu tun pflegen, sondern einander ermahnen, und das umso mehr, als ihr seht, dass sich der Tag naht.
Ein neues Kirchenjahr beginnt. Allen Leserinnen und Lesern ein von Gott gesegnetes Jahr in der Begegnung mit biblischen Texten.
Mit dem ersten Adventssonntag beginnt die sechste Predigtreihe. In unserem evangelischen Gesangbuch finden wir ab der Nummer 954 am Schluss der Lesungen hinter römischen Ziffern die Predigtreihen III – VI. Am Adventssonntag des Jahres 2008 beginnt die erste
Predigtreihe, die Predigten über die Epistellesung des jeweiligen Sonntages.
Das lateinische Wort Advent ist in der Bedeutung der des griechischen Wortes Epiphanias gleich. Ankunft wie Erscheinung bezeichnen die Ankunft Gottes im Tempel wie den ersten offiziellen Besuch eines Herrschers nach Antritt seiner Herrschaft.
Für uns Christen bezeichnen beide Begriffe sowohl die Ankunft Christi als auch seine erhoffte Wiederkunft.
Die Adventszeit ist nach christlichem Verständnis Fastenzeit. Die liturgische Farbe der Altar- und Kanzelbehänge ist deswegen violett. In den östlichen Kirchen umfasst diese Zeit, wenn man die Samstage und Sonntage als fasten freie Tage herausnimmt, zwischen dem 11. November und dem 6. Januar genau 40 Tage. Der Epiphaniastag war neben dem Osternacht der zweite große Tauftag. So wurde diese Zeit zu einer durch Fasten- und Bußübungen geprägten Vorbereitungszeit.
Die Predigttexte der sechsten Reihe stellen eine große Herausforderung an Prediger und Gemeinde dar. Dies wird schon in dem für den ersten Adventssonntag vorgesehenen Text deutlich. Die Verse 19 – 22 können zu dem eigentlichen Text hinzugenommen werden. (Im Schriftbild sind sie nicht fett gedruckt.)
Der Hebräerbrief ist eine „Trost- und Mahnrede“ (13, 22); also eine Predigt. „Auch wenn offensichtlich nur Gott die Wahrheit über den Verfasser kennt, so ist diese Homilie ein einzigartiges und notwendiges Zeugnis echt apostolischer Tradition“, heißt es in einem wissenschaftlichen Bibellexikon.
Das Thema dieser Predigt findet sich in Kapitel 8, Vers: Jesus ist der zum Gott erhöhte Hohepriester. Der Tod Jesu wird in diesem biblischen Text entsprechend der Funktion des Hohenpriesters am Versöhnungstag gedeutet. Diese Deutung wird aber durch eine Reihe weiterer Vorstelllungen ergänzt, die z.B. den Psalmen 2 und 110 oder auch christlichem Traditionsgut entstammen.
Dem Verfasser geht es in seiner Schrift vor allem um die Frage, wie die Menschen mit ihrer Schuld vor Gott bestehen können. Es ist aber nicht der Tempelkult, der darauf eine Antwort gibt, sondern der Christus, der als „Sohn“ und „Bruder“ die Existenzbedingungen des Menschen geteilt hat, um dadurch die „Versöhnung“ zu erwirken. Dieses einmalige Opfer der Versöhnung geschieht, weil Christus in seiner menschlichen Leidensfähigkeit und Erfahrung seine Vollendung erfahren hat. Christi eigenes Blut und Leben ist die einmalige Opfergabe, durch die die Gnade Gottes wirksam wird.
Unser Text ist der Beginn des dritten Teiles des Briefes, der von 10, 19 – 13, 25 reicht. Mit der Anrede „Brüder“ leitet der Verfasser dazu über, die vorher entwickelte Glaubensgrundlage in die entsprechenden Haltung und Praxis umzusetzen. Die „Mahnrede“ soll an ihr Ziel kommen und eine konkrete Ausrichtung der Adressaten erfahren.
Dies wird in Vers 23 angesprochen, wenn zum Festhalten am Bekenntnis der Taufe, das im Gottesdienst als Bekenntnis der Gemeinde gesprochen, aufgefordert wird. Dieser Ermahnung zum ständigen Bekennen wird nun in Vers 23 ein wichtiger Akzent hinzugefügt. Das Gemeinde- und Taufbekenntnis wird als ein „Bekenntnis der Hoffnung“ bezeichnet.
Gott steht zu seiner Verheißung, so hat es der Verfasser des Briefes in Kapitel 6, 11 in dem Verhalten Gottes gegenüber Abraham beispielhaft deutlich gemacht. Weil Gott zu seiner Verheißung steht, deswegen ist die Gemeinde zur „Bekenntnistreue“ verpflichtet.
Im Vers 25 wird in der Benennung des Mangels von „Liebe und guten Werken“ deutlich, dass dieser auf einen Mangel an „Glaube und Hoffnung“ zurückzuführen sind. Das Verlassen der Gemeinschaft lässt eine Gemeinde erkennen, die ihre erste Begeisterung verloren hat; also nicht mehr im Stande der urchristlichen Gemeinden ist.
Der Verfasser des Briefes möchte dem als Warnung die Unmittelbarkeit des Gerichts entgegensetzen, dem er in den unserem Predigttext folgenden Versen das Wort redet.
Der Predigttext zum Ewigkeitssonntag (25. November) steht im Evangelium des Markus, Kapitel 13, die Verse 31 – 37
Himmel und Erde werden vergehen; meine Worte aber werden nicht vergehen.
Von dem Tage aber und der Stunde weiß niemand, auch die Engel im Himmel nicht, auch der Sohn nicht, sondern allein der Vater.
Seht euch vor, wachet! Denn ihr wisst nicht, wann die Zeit da ist. Wie bei einem Menschen, der über Land zog und verließ sein Haus und gab seinen Knechten Vollmacht, einem jeden seine Arbeit, und gebot dem Türhüter, er solle wachen: so wacht nun; denn ihr wisst nicht, wann der Herr des Hauses kommt, ob am Abend oder zu Mitternacht oder um den Hahnenschrei oder am Morgen, damit er euch nicht schlafend finde, wenn er plötzlich kommt. Was ich aber euch sage, das ich allen: Wachet!
Der kommende Sonntag ist der letzte des Kirchenjahres; also Kirchensylvester. Im innerkirchlichen Sprachgebrauch hat sich die Bezeichnung „Ewigkeitssonntag“ durchgesetzt.
Die Gebete und die biblischen Texte bitten um das Kommen Christi und des Reiches Gottes.
Im Bewusstsein der evangelischen Christen ist dieser Sonntag aber vor allem der Gedenktag für die Verstorbenen, der „Totensonntag“. König Friedrich Wilhelm III. von Preußen ordnete 1816 an, jährlich den letzten Sonntag des Kirchenjahres als Feiertag zur Erinnerung an die Verstorbenen zu begehen. Sein Interesse mag darin bestanden haben, damit an die Gefallenen der Befreiungskrieg zu erinnern. In den evangelischen Landeskirchen wurde daraus ein Gegenstück zu der Feier von Allerseelen. So werden die Gräber zu diesem Sonntag geschmückt, die Friedhöfe besucht und in den Gottesdiensten der Toten des vergangenen Jahres gedacht.
Der Predigttext aus dem 13. Kapitel des Markusevangeliums ist ein Teil der „apokalyptischen Rede“, die Jesus unmittelbar vor seiner Passion, seinem Leidensweg hält. Mit dieser Rede beschließt er sein irdisches Wirken. Als Zuhörer werden im Vers 3 die vier Jünger Petrus, Jakobus, Johannes und Andreas genannt. Der Ort der Rede ist der Ölberg, von dem aus Jesus und die vier Jünger auf die Stadt und den Tempel herabsehen. Der Ölberg ist nach dem Propheten Sacharja der Ort, an dem Jahwe an seinem endgültigen Gerichtstag stehen wird.
An diesem Ort wird sich Jesus in seiner letzten Nacht aufhalten (14, 26).
Der Lehrer Jesus „sitzt“ auf dem Berg – wie an vielen anderen Stellen im Evangelium zu lesen – und lehrt einen ausgewählten kreis der Jünger. In der Doppelfrage der Jünger Vers 4 geht es um die Erhellung der in Dunkel gehüllten Zukunft des Tempels und damit der Zukunft Gottes. Die Ereignisse von 70 nach Christus mit der Zerstörung des Tempels scheinen noch nicht geschehen zu sein.
Aber die Zeichen der Endzeit sind deutlich: Pseudo-Heilsmittler treten auf; Nachrichten von Kriegen versetzen Menschen in Angst und Panik; ein Volk erhebt sich gegen das andere; Hungersnöte geschehen.
Hinzu kommen die Erfahrungen, die Christen mit Juden und Heiden machen. Sie werden verfolgt, ausgeliefert und vor Gericht gestellt. Der Evangelist Markus sieht in diesem Geschehen die Möglichkeit zum „Zeugnis“ der vor die Gerichte gestellten Christen.
Die als Gericht Gottes erscheinende kosmische Katastrophe spielt in ihrer lähmenden Wirkung keine Rolle, denn es erscheint nach Vers 26 und 27 der himmlische Menschensohn, Jesus, der den Tod erlitten hat und auferstanden ist. Er ist der Retter der von Juden und bedrängten Jünger. Sie folgen ihm auf dem Leidensweg, den er in dem nachfolgenden Kapitel 14 antritt.
Unser Predigttext beginnt unabhängig von der inhaltlichen Zuordnung dieses Textabschnittes ab Vers 28 mit dem Vers 31. Der Kosmos, Himmel und Erde, wird vergehen. Der Akzent dieses Verses liegt also auf der bleibenden Autorität der Worte Jesu. Die Wende zur Heilszeit ist Gottes Geheimnis.
In den Versen 33 – 37 steht der Aufruf zur Wachsamkeit im Mittelpunkt. Der Appell zu dieser Haltung wird durch ein Gleichnis verdeutlicht. Jeder erhält seine Aufgabe angesichts der Reise eines Hausherrn. Das Gleichnis ist allegorisch zu lesen. Der Hausherr ist Jesus. Unter den Mitarbeitern ist der Türhüter die zentrale Gestalt. Er muss mit der Unberechenbarkeit der Rückkehr seines Herrn rechnen; also Tag und Nacht wachsam sein. Die Gemeinde Christi ist zur Wachsamkeit aufgerufen, da sie den Termin seiner Wiederkunft in himmlischer Hoheit nicht kennt. Die im Text angegebenen Zeiten sind keine Tageszeiten, sondern solche zwischen anbrechender Dunkelheit und frühem Morgen und decken sich mit den Zeitangaben, die in der Leidensgeschichte die einzelnen Stationen beschreiben.
Der Ruf Jesu zum Wachen soll die Leser des Evangeliums wachrütteln, um sich anders als die Jünger bei dem Leiden Jesu zu verhalten.
Der Predigttext für den 19. Sonntag nach Trinitatis (14. Oktober) steht im Evangelium des Johannes, Kapitel 5, die Verse 1 – 16
Danach war ein Fest der Juden, und Jesus zog hinauf nach Jerusalem. Es ist aber in Jerusalem beim Schaftor ein Teich, der heißt auf Hebräisch Betesda. Dort sind fünf Hallen, in denen lagen viele Kranke, Blinde, Lahme, Ausgezehrte.
Es war aber dort ein Mensch, der lag achtunddreißig Jahre krank. Als Jesus den liegen sah und vernahm, dass er schon so lange gelegen hatte, spricht er zu ihm: Willst du gesund werden? Der Kranke antwortete ihm: Herr, ich habe keinen Menschen, der mich in den Teich bringt, wenn das Wasser sich bewegt; wenn ich aber hinkomme, so steigt ein anderer vor mir hinein. Jesus spricht zu ihm: Steh auf, nimm dein Bett und geh hin! Und sogleich wurde der Mensch gesund und nahm sein Bett und ging hin.
Es war aber an dem Tag Sabbat. Da sprachen die Juden zu dem, der gesund geworden war: Es ist heute Sabbat; du darfst dein Bett nicht tragen. Er antwortete ihnen: Der mich gesund gemacht hat, sprach zu mir: Nimm dein Bett und geh hin! Da fragten sie ihn: Wer ist der Mensch, der zu dir gesagt hat: Nimm dein Bett und geh hin? Der aber gesund geworden war, wusste nicht, wer es war; denn Jesus war entwichen, da so viel Volk an dem Ort war.
Danach fand Jesus ihn im Tempel und sprach zu ihm: Siehe, du bist gesund geworden; sündige hinfort nicht mehr, dass dir nicht etwas Schlimmeres widerfahre. Der Mensch ging hin und berichtete den Juden, es sei Jesus, der ihn gesund gemacht habe. Darum verfolgten die Juden Jesus, weil er dies am Sabbat getan hatte.
Das Thema des 19. Sonntag nach Trinitatis ist das der Sündenvergebung und Heilung. Die Lesungen und Predigttexte legen dieses Thema nahe. Unter diesem Themenschwerpunkt bereitet der zur fünften Predigtreihe gehörende Abschnitt aus dem Johannesevangelium gewisse Schwierigkeiten. Zum einen sind die zu dem Textabschnitt gehörenden Verse 17 und 18 dem Predigttext weggenommen und damit der inhaltliche Schwerpunkt verlagert worden.
Zum anderen ist sehr schnell sichtbar, dass der gesamte Abschnitt aus zwei ursprünglich selbständigen Erzählungen zusammengesetzt ist.
Der erste Teil – die Krankenheilung – umfasst die Verse 1 – 9a; während der zweite Teil – die Verse 9b – 18 – die Auseinandersetzung um den Sabbat als thematischen Schwerpunkt hat. So wäre der erste Teil ohne den zweiten sinnvoll, nicht aber der zweite Teil ohne den ersten.
Anzunehmen ist – wenn die Verse 17 und 18 als Teil des gesamten Textes gesehen werden – dass sich hier das Verhältnis der christlichen Gemeinden um das Jahr 100 nach Christus zu der ihr feindlich gesonnenen Umwelt widerspiegelt. Ein Teil dieser feindlichen Umwelt ist das Judentum, das nun mit den selbständig auftretenden christlichen Gemeinden in Konkurrenz gerät. So werden Menschen, die mit den christlichen Gemeinden in Berührung kommen und deren Wunder wirkende Kräfte erfahren haben, verhört, um Anklagepunkte gegen die Gemeinden zu finden.
Der auf Christus bezogene Sinn dieses Abschnittes wird in dem Vers 18 deutlich, wenn die Tötungsabsicht der Juden mit dem Argument begründet wird, Jesus handle im Namen Gottes. Nach johanneischer Vorstellung bricht mit diesem Anspruch Jesu – das als Sohn zu tun, was Gott tut - ein neues Zeitalter an. Diese Offenbarung des Willens Gottes in Jesus Christus bringt die „Welt“ in Verlegenheit, ja in ein feindliches Gegenüber. Sie macht der Offenbarung den Prozess.
„Das Offenbarungsgeschehen bedeutet die Störung und Verneinung der traditionellen religiösen Maßstäbe, und deren Vertreter müssen zu Feinden des Offenbarers werden.“ (R. Bultmann, Das Evangelium des Johannes, Kritisch-exegetischer Kommentar über das Neue Testament, 1950)
Mit der allgemeinen Angabe eines Festes wird in 5, 1 die Anwesenheit Jesu in Jerusalem begründet. Die Ortsangabe „ Teich Betesda“ (Haus der Barmherzigkeit oder Haus der Quellen), die fünf Hallen und die Jahreszahl 38 im Blick auf die Krankheit des einen Menschen sind für die Auslegung des Textes unwichtig.
Wichtiger für die Auslegung ist auf der einen Seite das Verhalten des Mannes, um dessen Heilung es geht. Er zeigt im Gegensatz zu anderen Heilungsbedürftigen, von denen die Evangelien erzählen, keinen Glauben und keine Freude. Im weiteren Verlauf des Textes übernimmt er keine Verantwortung für das Tragen seiner Bettrolle, denn nach jüdischem Gesetz macht er sich damit strafbar, da dies am Sabbat geschieht.
Natürlich hat der nun Gesunde recht mit seiner Antwort, dass er dem gehorcht hat, der in geheilt hat. Der bisher nicht ausgesprochene Zusammenhang von Sünde und Krankheit wird nun in Vers 14 aufgenommen. Der Geheilte wird nicht mit dieser Warnung zu einem Bekenntnis seines Glaubens geführt, sondern davor gewarnt, in die Sünde eines Denunzianten zu verfallen. Genau dies geschieht. Die Folge dieser „Sünde“ gebiert nun den Beginn einer neuen „Sünde“, nämlich die der Verfolgung des Gottessohnes.
Der Predigttext für den 18. Sonntag nach Trinitatis (7. Oktober) steht im 2. Buch Mose, Kapitel 20, die Verse 1 – 17
Und Gott redet alle diese Worte:
Ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus Ägyptenland, aus der Knechtschaft, geführt habe. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir.
Du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen, weder von dem, was oben im Himmel, noch von dem, was unten auf Erden, noch von dem, was im Wasser unter der Erde ist: Bete sie nicht an und diene ihnen nicht! Denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifernder Gott, der die Missetat der Väter heimsucht bis ins dritte und vierte Glied an den Kindern derer, die mich hassen, aber Barmherzigkeit erweist an vielen tausenden, die mich lieben und meine Gebote halten.
Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht missbrauchen; denn der Herr wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen missbraucht.
Gedenke des Sabbattages, dass du ihn heiligest. Sechs Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun. Aber am siebenten Tage ist der Sabbat des Herrn deines Gottes. Da sollst du keine Arbeit tun, auch nicht dein Sohn, deine Tochter, dein Knecht, deine Magd, dein Vieh, auch nicht dein Fremdling, der in deiner Stadt lebt. Denn in sechs Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht und das Meer und alles, was darinnen ist, und ruhte am siebenten Tage. Darum segnete der Herr den Sabbattag und heiligte ihn.
Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, auf dass du lange lebest in dem Lande, das dir der Herr, dein Gott geben wird.
Du sollst nicht töten. Du sollst nicht ehebrechen. Du sollst nicht stehlen. Du sollst nicht falsch Zeugnis reden wider deinen Nächsten.
Du sollst nicht begehren deines Nächsten Haus. Du sollst nicht begehren deines Nächsten Frau, Knecht, Magd, Rind, Esel noch alles, was dein Nächster hat.
Die neutestamentliche Lesung des Sonntages gibt das Thema dieses Sonntages an: das Doppelgebot der Liebe. Der in der diesjährigen fünften Predigtreihe vorgesehene Predigttext aus dem 2. Buch Mose umfasst die „zehn Gebote“, den Dekalog. Im fünften Buch Mose findet sich eine weitere Fassung des Dekaloges. Die Forschung hat sehr genau untersucht, welche der beiden Fassungen die ältere sei, da man davon ausgehen muss, dass die biblischen Texte eine lange Entwicklungsgeschichte haben. Dies wird auch an dem Predigttext sichtbar. Auffallend ist die unterschiedliche Länge der Gebote; der negativ und positiv formulierten Gebote und derer, die mit oder ohne Begründungen ausgestattet sind. Das erste Gebot beginnt mit einer Gottesrede. Im zweiten Gebot wird von Gott in dritter Person gesprochen.
Der Dekalog dürfte seinen zentralen Platz im kultischen Leben, also im Gottesdienst Israels gehabt haben. Im Rahmen des Gottesdienstes wird das „Gottesrecht“ verkündet, denn der Beginn – das erste Gebot – ist eine „Selbstvorstellungsformel“, mit der das Tun Gottes die Forderungen begründet. Dies wird besonders im 81. Psalm deutlich, wenn es dort heißt: „Höre, mein Volk, ich will dich ermahnen. Israel, du sollst mich hören! Kein andrer Gott sei unter dir, und einen fremden Gott sollst du nicht anbeten!“
Diese Verbindung der 10 Gebote zum Gottesdienst findet sich auch in unseren Gottesdienst, wenn diese bei der Feier der Beichte als Beichtspiegel benutzt werden.
Betrachtet man den Zusammenhang unseres Textes mit den vorausgehenden und nachfolgenden Texten des zweiten Buches Mose, dann wird sichtbar, dass rechtliche Texte in geschichtliche Zusammenhänge eingebunden sind. Alle fünf Bücher enthalten Geschichten und Gesetze im Verhältnis von 50 zu 50.
Die Texte des 2. Buches Mose erzählen den Weg des Volkes in das von Gott verheißene Land. Auf diesem Weg in die „Freiheit“ werden zehn Sätze, wie die Finger der beiden Hände, zu Merksätzen, die diese Freiheit schützen.
Die zehn Gebote sind Offenbarung Jahwes. So erzählt es die Geschichte vom Berg Gottes. Das Tun Gottes an Israel geht allen Forderungen voraus. Die Hauptsache wird so die unbedingte Ausschließlichkeit der Anerkennung und Verehrung Gottes. Eine kultische Verehrung „anderer Götter“ wird ausgeschlossen.
Dem Bilderverbot liegt der in diesem Kulturraum verbreitete Gedanke zu Grunde, dass man mit Hilfe eines Bildes Macht über das abgebildete Wesen haben könne. Jeder Versuch sollte also abgewehrt werden, dass man über seinen Gott mit einer Abbildung Macht gewinnen könne.
Inhaltlich folgt dem Bilderverbot das Verbot des Aussprechens des Gottesnamens zu einem nicht wertvollen Zweck. Dahinter steht die Auffassung, dass der Namensträger in seinem Namen anwesend ist. So kann die im Gottesnamen vorhandene göttliche Macht zu Beschwörungs- und Zauberhandlungen ausgenutzt werden.
Die Heiligung des Sabbattages dürfte darin ihren Ursprung und Bedeutung haben, dass er der „Tag Gottes“ ist. In der Schöpfungsgeschichte 1. Mose 1, 1ff. wird deutlich, dass Gottes Möglichkeiten universal sind. Die gesamte Schöpfung ist sein Geschenk an den Menschen. Der Sabbat ist Gottes Tag, an dem der Mensch mit Respekt und Ehrfurcht seinem Schöpfer und Erhalter begegnet.
Das Elterngebot erinnert Erwachsene daran, ihren alt gewordenen Eltern die nötige Ehre entgegen zu bringen.
Das Verbot des Tötens meint hier das eigenmächtige Töten, nicht das der Bestrafung und des Tötens im Kriege.
Das Verbot des Ehebruchs ist eindeutig, wobei nach damaligem Verständnis bereits die Verlobung eine ehe rechtlich begründet.
Das Verbot des Diebstahls dürfte sich auf die Freiheitsberaubung gegenüber freien Israeliten beziehen. Es ist also Israeliten verboten, eigene Volksangehörige gewaltsam zum eigenen Gebrauch oder zum Verkauf zu versklaven.
Das Verbot der lügnerischen Zeugenaussage geht davon aus, dass die Gerichtsverhandlungen unter freien Israeliten auf einem der Dorf- oder Stadtgemeinschaft zugänglichen Platz „im Tor“ stattfanden. Mit dem „Nächsten“ ist der Mensch gemeint, mit dem in direkter Gemeinschaft lebt.
Das abschließende Gebot spricht alle Unternehmungen an, durch Diebstahl oder unlautere Machenschaften den gesamten Besitz oder Teile davon einem „Nächsten“ weg zu nehmen. Die zehn Gebote sind eine kurze Zusammenfassung der Gottesverehrung und des Zusammenlebens unter den Menschen.
Die Erwählung des Volkes Israel zu dem Volk, mit dem Gott einen Bund macht, gibt dem Zusammenleben der Angehörigen dieses es eine besondere Qualität. Alle Volksangehörigen sind Teilhaber an der Gottesgemeinschaft. So sollen sie auch untereinander leben.
Der Predigttext für das Erntedankfest am 30. September 2007 aus dem Evangelium des Matthäus, Kapitel 6, die Verse 19 – 24
Ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erde, wo sie die Motten und der Rost fressen und wo die Diebe einbrechen und sie stehlen. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo sie weder Motten noch Rost fressen und wo die Diebe nicht einbrechen und stehlen. Denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz.
Das Auge ist das Licht des Leibes. Wenn dein Auge lauter ist, so wird dein ganzer Leib licht sein. Wenn aber dein Auge böse ist, so wird dein ganzer Leib finster sein. Wenn nun das Licht, das in dir ist, Finsternis ist, wie groß wird dann die Finsternis sein.
Niemand kann zwei Herren dienen: Entweder er wird den einen Hassen und den anderen
Lieben, oder er wird an dem einen hängen und den andern verachten.
Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon.
Das Erntedankfest wird in den evangelischen Gemeinden am Sonntag nach dem Michaelistag gefeiert. Der Michaelistag fällt immer auf den 29. September. In den christlichen Kirchen zählen Michael „Wer ist wie Gott“, Gabriel und Rafael zu den besonders herausgehobenen Boten Gottes. Biblische Hinweise für Michael finden sich im Danielbuch des Alten Testamentes (Daniel 12) und in der Offenbarung des Johannes im Neuen Testament (Offenbarung 12). Michael und alle anderen Engel bekämpfen die bösen Mächte, die in einer Endphase eines Weltzeitalters die Welt und die darin lebenden Menschen bedrohen. Dieses apokalyptische Weltzeitdenken war zu der Zeit Jesu besonders ausgeprägt. Das schreckliche Ende der Weltzeit endete mit dem Gericht Gottes, dem Beurteilen der Menschen in Gute und Böse und dem Beginn der Heilszeit Gottes.
Die besondere Funktion des Michael als herausragender Kämpfer gegen alles Böse ließ ihn sehr bald zum Schutzpatron der Kirche und des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation werden, von wo aus er dann zum „deutschen Michel“ wird.
Mittelalterliche Michaeliskirchen entstanden in der Regel an Orten, die vor der Entstehung des Christentums nichtchristliche Kultorte waren.
Die Entstehungszeit des Matthäusevangeliums wird weitestgehend um 80 nach Christus angenommen. Seine hervorgehobene Stellung als erstes der vier Evangelien ist von daher nicht begründet. Die erzählenden Teile dieses Evangeliums sind im ältesten der vier Evangelien, dem Markusevangelium zu finden. Der größere Umfang ergibt sich daher, dass der Verfasser auf neuen Stoff zugegriffen hat. Dieser findet sich vor allen in den fünf Redekomplexen des Evangeliums wieder. In der Verbindung von geschichtlichen und lehrhaften Stoffen aus dem Leben Jesu und der Verknüpfung mit alttestamentlichen Schriftstellen will der Verfasser die Erfüllung des von Gott verheißenen Heils aufzeigen.
Die ersten Adressaten des Evangeliums dürften christliche Gemeinden in Syrien gewesen sein. Der Verfasser, der nach frühchristlicher Tradition die Autorität seines Evangeliums dadurch betont, dass seine Verfasserschaft dem Zolleinnehmer und Jünger Matthäus (Kapitel 9, 9) zugeschrieben wird, dürfte unter den Judenchristen in Syrien zu vermuten sein.
Die Trennung zwischen der jüdischen Synagogengemeinde und der christlichen Gemeinde ist schon vollzogen. Die christliche Gemeinde des Matthäusevangeliums hat einen eigenen Charakter. Sie zeigt noch eine starke Verbindung zum historischen Jesus. Seine Weisungen und ethischen Forderungen, die einen asketischen Zug zeigen, werden wörtlich übernommen.
Die Bergpredigt Jesu, die wir in den Kapiteln 5 – 7 des Evangeliums lesen und aus der auch der Abschnitt des Predigttextes ist, ist eine „Jüngerrede“. Aber nach dem Verständnis ist jeder ein Jünger, der sich von Gott rufen lässt. „Und es begab sich, als Jesus diese Rede vollendet hatte, das sich das Volk entsetzte über seine Lehre.“ (7, 28)
Der Predigtabschnitt 6, 19 – 24 schließt inhaltlich an das in den Versen 1 – 18 sichtbare Schema von Lohn bei Menschen und Lohn bei Gott an. Das Gottesverhältnis Jesu ist bestimmt von diesem her. „Dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird dir´s vergelten.“ (Vers 18
Die Antithese „vor Gott“ und „vor den Menschen“ wird in den Versen 19 – 24 dreifach variiert.
Den der Vernichtung preisgegebenen irdischen Schätzen werden den dauerhaften himmlischen Schätzen gegenüber gestellt. Nach alttestamentlicher Vorstellung sollte der Fromme sich einen Schatz von guten Taten anlegen, der diesem in Zeiten der Not zur Verfügung steht und bei Gott angerechnet wird. Dies ist hier anders gemeint. Wer sich von Jesus rufen lässt und nach seiner Weisung lebt, dem gibt Gott einen dauerhaften Lohn, der nicht beschrieben wird. Gottes reiches Schenken soll unser Schatz sein.
In den Versen 22 und 23 kommt die Person dessen ins Bewusstsein, der „Schätze“ sammelt.
Das Auge ist nach antikem Verständnis die Lichtquelle, die den Körper erleuchtet. Sa kann der Mensch mit „richtigem“ Auge alle4s auf Erden zur Freude und zum Geschenk Gottes bestimmt, während der böse Blick das Leben verfinstert.
Der dritte Spruch Vers 24 nimmt die vorhergehenden Sprüche des Sammelns von Schätzen und dem richtigen und falschen Sehen auf und zeigt, dass es insgesamt um den richtigen oder falschen Gottesdienst geht.
Jesus will den Menschen hineinziehen in seine Freude an Gott. So wird der Blick frei für die
Gaben Gottes. Oder der Mensch wird beherrscht von dem Mammon (ein Begriff aus der aramäischen Sprache – der Sprache Jesu: Mammon = Besitz in seiner „quasi-personhaften Mächtigkeit“
Ein Ausleger beschreibt dies so: „ Von Mammongesellschaft ist schon zu reden, wenn die Materialisierung aller Lebensbereiche ständig vorangetrieben wird.“
Der Predigttext für den 16. Sonntag nach Trinitatis (23. September) steht im Evangelium des Lukas Kapitel 7, die Verse 11 – 16
Und es begab sich danach, dass er in eine Stadt mit Namen Nain ging; und seine Jünger gingen mit ihm und eine große Menge. Als er aber nahe an das Stadttor kam, siehe, da trug man einen Toten heraus, der der einzige Sohn seiner Mutter war, und sie war eine Witwe;
und eine große Menge aus der Stadt ging mit ihr. Und als sie der Herr sah, jammerte sie ihn und er sprach zu ihr: Weine nicht! Und trat hinzu und berührte den Sarg, und die Träger blieben stehen. Und er sprach: Jüngling, ich sage dir, steh auf! Und der Tote richtete sich auf und fing an zu reden, und Jesus gab ihn seiner Mutter.
Und Frucht ergriff sie alle, und sie priesen Gott und sprachen: Es ist ein großer Prophet unter uns aufgestanden, und: Gott hat sein Volk besucht.
Die Lesungen und der Predigttext des heutigen Sonntags haben die Macht Jesu über den Tod zum Thema. Bevor ich auf den eigentlichen Predigttext eingehe, gebe ich einige Hinweise zum Verständnis des gesamten Evangeliums. In dem Vorwort Kapitel 1, 1ff. gibt Lukas an, dass er den Leserinnen und Lesern Gewissheit in dem geben möchte, in dem sie unterrichtet sind. Lukas setzt christlichen Unterricht voraus und schreibt demnach in dem Evangelium und der Apostelgeschichte ein „Informationsbuch“ über den Weg Jesu von seiner Geburt bis zu dessen Aufnahme in den Himmel (Evangelium), sowie den erfolgreichen Lauf der christlichen Botschaft von Jerusalem nach Rom (Apostelgeschichte).
Das Evangelium ist in vier Abschnitte einzuteilen. Kapitel 1 – 4 umfassen die Anfänge der Geschichte Jesu. Hier finden wir die uns so vertraute „Weihnachtserzählung von Bethlehem“.
Das missionarische Wirken Jesu findet sich dann in den Kapiteln 5 – 9, 50. Hier ist eine deutliche Zäsur, die das Evangelium in zwei Teile aufteilt. Ab Kapitel 9, 51 – 19, 10 folgt ein Abschnitt, den man mit „Jesu Lehre auf dem Weg“ überschreiben könnte. In diesem Abschnitt finden sich Äußerungen zum Leben in der Nachfolge Jesu und einem entsprechenden Lebenswandel. Der letzte Abschnitt von Kapitel 19, 11 – 24, 53 nimmt das Geschehen von Kreuzigung und Auferstehung in den inhaltlichen Zusammenhang von der Vollendung der Welt.
Die theologische Absicht des Lukas ist nicht die einer ausgefeilten Theologie. „Konzeptionen“ christlicher Lehre finden sich im Neuen Testament bei Paulus, bei den Verfassern des Hebräerbriefes oder des Johannesevangeliums. Seine theologische Absicht findet sich in der Apostelgeschichte Kapitel 16, Vers 17: „Diese Männer sind Diener des höchsten Gottes, die euch den Weg des Heils verkünden.“ Es geht also Lukas um das Heil in und durch Jesus Christus und um den Weg dazu. Diesen Weg in die Nachfolge Jesu beschreibt er in der Abfolge vieler Ereignisse.
Es fällt auf, dass Lukas in Kapitel 2, 1 und 3, 1f. Zeitangaben zu den geschilderten Ereignissen macht, die diese in einen bekannten historischen Rahmen einordnen. Er möchte damit sein Evangelium weltgeschichtlich verankern und damit eine unhistorische Darlegung und Auslegung verhindern. So wird man Lukas als den ersten christlichen Historiker bezeichnen können.
Der Herr der Geschichte ist nach Lukas Gott. Er ist es, der in Jesu Auftreten und Wirken den Menschen nahe kommt. So führt Lukas den Stammbaum Jesu (3, 38) bis zu Gott hin. Jesus redet Gott im Gebet „Vater“ an, um damit dessen erbarmende Zuneigung zum Menschen deutlich zu machen, wie es das Gleichnis vom heimkehrenden Sohn zeigt.
Mit besonderes großer Aufmerksamkeit beachtet Lukas die Randsiedler der Gesellschaft in seinem Evangelium Die Armen werden positiv gezeichnet; Lazarus kommt nach seinem Tod in „Abrahams Schoß“ ohne etwas Gutes geleistet zu haben. Die Samaritaner und die Zöllner
werden in die Gemeinschaft mit Jesus geholt; die Frauen als Mitarbeiter und Helfer Jesu dargestellt.
In den Kapiteln 9 und 22 widmet sich Lukas besonders der Berichterstattung über die Jünger. Sie sollen die Gottesherrschaft zu den Menschen bringen. Sie tun es und kommen voller Begeisterung zurück. In der Nähe Jesu aber können sie nur Hilfsdienste leisten und verteidigen in der Not weder die Sache Jesu noch sich selbst. Von dem Auferstandenen und seinem lebendig machenden Geist werden sie befähigt, den richtigen Weg zu gehen und das Wort des Evangeliums zu verkünden. Die Nachfolge Jesu ist Verkündigungsdienst. In ihm wird die Herrschaft Gottes in Worten und Wundern angekündigt und nahegebracht.
Unser Predigttext steht im Zusammenhang des zweiten Abschnittes des Lukasevangeliums von Kapitel 5, 1 – 9, 50 „Jesu missionarisches Wirken“. Der Unterabschnitt von 7, 1 – 8,56 schildert in den dort stehenden Wundergeschichten die Wirkung des Glaubens an Jesus. Unsere Erzählung schließt an die Wunderheilung des Knechts des Hauptmanns von Kapernaum an. Die Erzählung von der Auferweckung des Jünglings zu Nain findet sich in den Evangelien nur bei Lukas. Der Ort Nain liegt etwa 10 km von Nazareth in der Nähe des Ortes, in dem nach 1. Könige 17 der Prophet Elia den Sohn einer Witwe vom Tode erweckt.
Unser Problem mit dieser Wundergeschichte ist, dass wir die Totenerweckung auf eine medizinische Frage reduzieren. Es dürfte auch kein Ausweg sein, dass man der Vermutung nachgeht, die Auferweckten seien scheintot gewesen. Nach antikem Todesverständnis war der Mensch dann tot, wenn seine Seele den Körper verlassen hat. Für Lukas war der junge Mann aus dem Ort Nain tatsächlich tot. Das von vielen Menschen wahrgenommene Totengeleit für den einzigen Sohn einer Witwe beschreibt die Größe des Leides.
In Vers 13 wird mit der Bezeichnung „der Herr“ angekündigt, in welcher Vollmacht nun Jesus in das Geschehen eingreift. Die Menschenmenge zeigt ihr Mitgefühl, indem sie die Witwe begleitet. Jesus, der Herr, aber kann mehr. Aufgrund seines Wortes geschieht das Wunder, das die Menschen an den alttestamentlichen Propheten erinnert. In ihm sehen sie – wie zu Zeiten des Elia – die Gegenwart Gottes.
Für Lukas befinden sich Wunder, Totenwerweckungen und die Evangeliumsverkündigung auf einer Ebene. Auf die unserem Text folgende Anfrage Johannes des Täufers antwortet Jesus: Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden rein, Taube hören, Tote stehen auf, Armen wird das Evangelium gepredigt (7, 22)
Jesus ist der Herr über Leben und Tod. Es gibt für ihn keine hoffnungslosen Fälle.
In der Verkündigung Jesu und den dazu gehörenden Wundern wird die Gegenwart des Reiches Gottes erfahren. Der Gegensatz zu dem Reich und der Herrschaft Gottes ist das des Satans. Seine Macht zeigt sich besonders in Krankheiten und dem Tod, der – wie in unserem Predigttext – die Zukunft einer Frau, der rechtlosen und sozial isolierten Witwe bedroht.
Lukas ist sich bewusst, dass er in einer Zwischenzeit zwischen der Auferstehung Jesu und dem Ende der Welt lebt. Es gilt für ihn, die Durchhaltekraft zu haben, „bis der Menschensohn kommt“ (18,8) Deshalb ruft er zum Wachsein auf. Wenn die Welt untergeht, wird die Erlösung geschehen. Wichtig ist aber, in der gegenwärtigen Zeit durch das Wort Gottes schon Anteil an seiner Herrschaft und Gegenwart zu erhalten.
Der Name und Lebensdaten des Verfassers des dritten Evangeliums kommen im Evangelium nicht vor. Die kirchliche Tradition hat sich an die wenigen Angaben in den Paulusbriefen angeschlossen, die den Arzt Lukas im Gefolge des Paulus als Verfasser des Evangeliums und der Apostelgeschichte sieht. Weitergehende Überlegungen, die sich auf außerbiblische Quellen stützen, sehen in ihm einen Katecheten, der in verschiedenen Gemeinden an der Mittelmeerküste tätig war. Die Abfassung seiner Schriften dürfte dann im Bereich von Philippi (Griechenland) geschehen sein. Die Abfassungszeit wird zwischen 65/70 und 90 nach Christus angenommen. Weiter dürfte sicher sein, dass er über seine Familie oder die Nähe zu einer jüdischen Gemeinde Verbindungen in die jüdische Religion gehabt hat. Diese Gruppe der dem Judentum nahe stehenden nannte man „Gottesfürchtige“. Unter ihnen ist die Missionstätigkeit der Christen erfolgreich gewesen.
Der Predigttext für den 15. Sonntag nach Trinitatis (16. September) aus dem Evangelium des Lukas, Kapitel 17, die Verse 5- 6
Und die Apostel sprachen zu dem Herrn: Stärke uns den Glauben! Der Herr aber sprach: Wenn ihr Glauben hättet so groß wie ein Senfkorn, dann könntet ihr zu diesem Maulbeerbaum sagen: Reiß dich aus und versetze dich ins Meer! Und er würde euch gehorchen.
Das Motiv der „Sorge“ bestimmt den Eingangspsalm, die Evangelienlesung und das Hauptlied des Sonntages. Der Wochenspruch für die kommende Woche lautet: „Alle eure Sorge werft auf ihn; denn er sorgt für euch.“
Der Predigttext nimmt das Thema der „Sorge“ auf. Es gibt nicht nur eine Sorge um die Kleidung und die Nahrung, sondern auch um den Glauben.
Der Predigttext steht im Zusammenhang des Textabschnittes Kapitel 17, 1 – 18, 8 des Lukasevangeliums. Dieser Abschnitt enthält die verschiedenen Aspekte des Glaubens.
Scheinbar unvermittelt bitten die Jünger um die Mehrung des Glaubens. Nach dem Inhalt der diesem Text vorausgehenden Verse 3 und 4, in denen der Glaube die Kraft besitzt, seinem Mitchristen immer wieder zu vergeben, geht es also um die Bitte der Jünger nach der Durchhaltekraft des Glaubens. Die Verwendung des Begriffs „Apostel“ und der Anrede „Herr“ gegenüber Jesus weist auf Verantwortliche in der Gemeindeleitung hin, deren Anliegen hier zur Sprache kommt.
Der Erwartungshaltung der Jünger, mehr und größere Kraft für die große Aufgabe der Gemeindeleitung zu erhalten, wird die Gegenwart des vorhandenen Glaubens entgegengesetzt. Das surreale Bildwort vom Senfkorn ist skuril in seiner Aussage. Der im Bildwort gemeinte Maulbeer- oder Maulbeerfeigenbaum gilt wegen seines Wurzelwerkes geradezu als unausreißbar. Im Sprachgebrauch der damaligen Zeit ist der Gebrauch des Begriffes „Senfkornes“ ein Ausdruck für die Winzigkeit und das kaum zu entdeckende Vorhandensein benutzt worden.
Jesus lehrt also, dass es beim Glauben nicht um mehr oder weniger geht, sondern um den Glauben selbst. Das Wort vom Senfkorn quantifiziert nicht den Glauben, sondern qualifiziert ihn.
Der Predigttext für den vierzehnten Sonntag nach Trinitatis (9. September) ist das Kapitel 28 des ersten Buches Mose
Da rief Isaak seinen Sohn Jakob und segnete ihn und sprach zu ihm: Nimm dir nicht eine Frau von den Töchtern Kanaans, sondern mach dich auf und zieh nach Mesopotamien zum Hause Betuels, des Vaters deiner Mutter und nimm dir dort eine Frau von den Töchtern Labans, des Bruders deiner Mutter. Und der allmächtige Gott segne dich und mache dich fruchtbar und mehre dich, dass du werdest eine Haufe von Völkern, und gebe dir den Segen Abrahams, dir und deinen Nachkommen mit dir, dass du besitzest das Land, darin du jetzt ein Fremdling bist, das Gott dem Abraham gegeben hat. So entließ Isaak den Jakob, dass er nach Mesopotamien zog zu Laban, dem Sohn des Aramäers Betuel, dem Bruder Rebekkas, Jakobs und Esaus Mutter. Nun sah Esau, dass Isaak Jakob gesegnet und nach Mesopotamien entlassen hatte, um sich dort eine Frau zu nehmen; er hatte ihn nämlich gesegnet und ihm geboten: Du sollst dir keine Frau nehmen von den Töchtern Kanaans. Auch sah Esau, dass Jakob seinem Vater und seiner Mutter gehorchte und nach Mesopotamien zog und dass Isaak, sein Vater, die Töchter Kanaans nicht gerne sah. Da ging er hin zu Ismael und nahm zu den Frauen, die er bereits hatte, Mahalat, die Tochter Ismaels, des Sohnes Abrahams, die Schwester Nebajots, zur Frau.
Aber Jakob zog aus von Beerscheba und machte sich auf den Weg nach Haran und kam an eine Stätte, da blieb er über Nacht, denn die Sonne war untergegangen. Und er nahm einen Stein von der Stätte und legte ihn zu seinen Häupten und legte sich an der Stelle schlafen. Und ihm träumte, und siehe, eine Leiter stand auf Erden, die rührte mit der Spitze an den Himmel, und siehe, die Engel Gottes stiegen daran auf und nieder. Und der Herr stand oben darauf und sprach: Ich bin der Herr, der Gott deines Vaters Abraham, und Isaaks Gott; das Land darauf du liegst, will ich dir und deinen Nachkommen geben. Und dein Geschlecht soll werden wie Staub auf Erden, und du sollst ausgebreitet werden gegen Westen und Osten, Norden und Süden, und durch dich und deine Nachkommen sollen alle Geschlechter auf Erden gesegnet werden. Und siehe, ich bin mit dir und will dich behüten, wo du hinziehst, und will dich wieder herbringen in dies Land. Denn ich will dich nicht verlassen, bis ich alles tue, was ich dir zugesagt habe.
Als nun Jakob von seinem Schlaf aufwachte, sprach er: Fürwahr, der Herr ist an dieser Stätte, und ich wusste es nicht! Und er fürchtete sich und sprach: Wie heilig ist diese Stätte! Hier ist nichts anderes als Gottes Haus, und hier ist die Pforte des Himmels. Und Jakob stand früh am Morgen auf und nahm den Stein, den er zu seinen Häupten gelegt hatte, und richtete ihn auf zu einem Steinmal und goss Öl oben darauf und nannte die Stätte Bethel, vorher aber hieß die Stadt Lus.
Und Jakob tat ein Gelübde und sprach: Wird Gott mit mir sein und mich behüten auf dem Wege, den ich reise, und mir Brot zu essen geben und Kleider anzuziehen und mich mit Frieden wieder heim zu meinem Vater bringen, soll der Herr mein Gott sein. Und dieser Stein, den ich aufgerichtet habe zu einem Steinmal, soll ein Gotteshaus werden; und von allem, was du mir gibst, will ich dir den Zehnten geben.
Ein ungewöhnlich langer Predigttext, der sich entweder zum Erzählen oder aber zur Konzentration auf einen Teil des Ganzen anbietet. (Die alttestamentliche Lesung des Sonntags verkürzt den Text auf den Abschnitt, Kapitel 28, die Verse 10 – 19a.) Das Thema des 14. Sonntages nach Trinitatis ist „Der barmherzige Samariter“ oder die „Gotteskindschaft“.
Die Verse 1- 9 des Predigttextes müssen eigentlich mit dem Vers 46 des Kapitels 27 zusammen gelesen werden. Von den Auslegern der Schriften des Alten Testamentes wird ein inhaltlicher Anknüpfungspunkt dieses Abschnittes an die nachexilische Zeit (nach 515 vor Christus) gesehen. Während im 5. Buch Mose, dessen historischer Hintergrund die Zeit um 600 vor Christus widerspiegelt, es noch unproblematisch ist, Ehen mit nichtjüdischen Frauen einzugehen (5. Mose 21, 10 -14), ist nun das Mischehenproblem mit großer Schärfe aufgebrochen. Die aus dem Exil kommenden mussten sich in der Heimat Israel zurechtfinden, in der Angehörige benachbarter Völker wohnten.
Mit der Autorität der Vätergeschichten wird also eine für die Gegenwart notwendige Handlungsweise begründet.
(Ich gehe hier und auch bei der Betrachtung des nachfolgenden Textteiles nicht auf die unterschiedliche Entwicklung der Entstehung der Vätergeschichten ein. Dies würde die Einführung zu einem Predigttext sprengen.)
In dem Abschnitt der Verse 10 – 22 sind zwei wesentliche Ereignisse festgehalten. Einmal die Erzählung eines von einem Erzvater – nämlich Jakob – entdeckten Heiligtums und zum anderen die Begegnung mit einer Gottheit, aus der Jakob bestätigt und gestärkt angesichts einer ungewissen Zukunft hervor geht.
Die Erzählung, die mit Vers 10 beginnt, versetzt den Leser geschickt in längst vergangene Zeiten, in denen der berühmte Ort Bethel noch öde und ohne Siedlung ist. Dieser Ort hatte sicher seine große Zeit als Wallfahrtsort um 900 vor Christus (1. Könige 12, 26 – 29) Es ist der zentrale Kultort des Nordreiches, der auch nach der Inbesitznahme durch die Assyrer im Jahre 722 noch seine Bedeutung als Jahweheiligtum behalten hat. Von Josia, dem König des Südreiches wird er um 622 erstört. Offensichtlich aber hat dieser Ort schon in der Zeit vor der Besiedlung durch die Israeliten eine kultische Funktion gehabt, denn der Ortsname wird als Gottesname gebraucht. (Amos 5,4f.)
Die im Traum sichtbare „Himmelleiter“ ist eine treppenartige Aufschüttung; eine „Stiege“ auf der das gleichzeitige Auf- und Niedersteigen der ungeflügelten Gottesboten geschieht.
Nach dem Weltbild der damaligen Zeit gibt es eine schmale Stelle, ein „Himmelstor“ durch das der Verkehr zwischen der Erde und der oberen göttlichen Welt geschieht.
In der nun folgenden Gottesoffenbarung stellt sich Jahwe als „Vätergott“ vor. Die Doppelverheißung von Land und Menschen weist auf das Vertrauen hin, das in der nomadischen Zeit des Volkes entsteht. Das Erlebnis der Nacht lässt „Jakob“ erfahren, dass „Gott gegenwärtig ist“.
In dem nun folgenden Text wird nun die Entstehung des Kultortes Bethel und seiner Heiligkeit aus israelitischer Sicht erzählt. Der Erzvater Jakob hat den „Stein“ von Bethel aufgerichtet, ihn gesalbt und mit der Ölweihe Gott übereignet. Spätere Generationen treten in die Nachfolge und das Bekenntnis des Jakob ein, indem sie dort den Zehnten entrichten.
Die Erzählung will also die Berufung des Jakob durch die Jahweoffenbarung, den Gründer des Heiligtums und den Initiator des dort geübten Abgabenwesens sichtbar machen.
Frau Professorin Gisela Kittel in Göttinger Predigtmeditationen, 61. Jahrgang Heft 4, S. 493f.
Warum die „Bibel in gerechter Sprache“ die Gemeinde entmündigt
„Dass eine christliche Versammlung oder Gemeinde Recht und Macht habe, alle Lehre zu urteilen…(Titel einer Lutherschrift aus dem Jahre 1523) – stand einmal als unverrückbarer
Grundsatz am Anfang der evangelischen Christenheit. Es war Luthers Überzeugung, dass sich alle christliche Lehre, ob von Bischöfen, Gelehrten oder Konzilen vorgetragen, an der Schrift messen lassen müsse und das die Gemeinde zu solcher Beurteilung das Recht und die Pflicht hätten. Dazu hatte Luther die Bibel ins Deutsche übersetzt, damit die Gemeinden mündig würden und jeder einzelne Christ seines Glaubens gewiss sein könnte.
Dieser Grundsatz, in unserer Zeit des Fachgelehrtentums längst brüchig geworden, ist nun
mit der „Bibel in gerechter Sprache“ endgültig über Bord gegangen. Denn der Maßstab, an dem die Gemeinden alle Lehre prüfen könnten, wird ihnen mit dieser Bibel entzogen. Hier wird – und das bewusst und systematisch! – ineinander vermischt, was bisher strikt getrennt war; die umstrittenen und diskutierten Meinungen und Hypothesen der Bibelwissenschaft zur Auslegung einzelner Texte und die Übersetzung, die – der Eigenaussage der Texte verpflichtet – durch das Achten auf Grammatik, Semantik, Kontext u. ä. sehr sorgfältig vorzunehmen ist und in ständigen Bibelrevisionen auch immer wieder überprüft wurde. In der hier besprochenen Bibel dagegen ist nicht eine im Sinne der Herausgeber und Autorinnen „gerechte“ Sprache angewendet worden, hier sind die exegetischen Positionen und theologischen Überzeugungen in die Übersetzung mit hineingeschrieben und die Bibeltexte in erheblicher Weise verändert.
In welchem Maß das passiert ist, sei an einem reformatorische Theologie zentral berührenden Textabschnitt im Römerbrief des Apostels Paulus demonstriert. In Römer 3, 27.28 bringt Paulus seinen 1,16ff. beginnenden Gedankengang über die Offenbarung der Gerechtigkeit Gottes im Evangelium in kurzen, stakkatohaft gestalteten leidenschaftlichen Sätzen zum Abschluss: „Wo nun der Ruhm? Er ist ausgeschlossen! Durch welches Gesetz? Der Werke? Nein, sondern durch das Gesetz des Glaubens. Denn wir sind zu dem Urteil gekommen, dass der Mensch durch den Glauben gerechtfertigt wird, ohne die Werke des Gesetzes.“ In der „Bibel in gerechter Sprache hören wir diese Sätze so: „Können wir dann noch auf etwas stolz sein? Das ist ausgeschlossen. Welches Verständnis der Tora ist gemeint? – eines, das allein auf Anstrengungen basiert? Nein, das ist es nicht, sondern eines, das auf Vertrauen gründet. Nach reiflicher Überlegung kommen wir zu dem Schluss, dass Menschen auf Grund von Vertrauen gerecht gesprochen werden – ohne dass schon alles geschafft wurde, was die Tora fordert.“ – Das ist Auslegung. Ein bewusster Versuch, die Rechtfertigungslehre des Apostels zu entschärfen, eine Umdeutung, Paulus in den Mund gelegt um der erstrebten Verständigung mit dem Judentum willen, - doch die Worte des Paulus sind das nicht. Wäre Luther in seiner Wittenberger Mönchszelle diese Übersetzung vor Augen gewesen, hätte er weiterhin im Kloster bleiben müssen. Das rettende Evangelium wäre ihm so nicht begegnet. Selbst die mittelalterliche Kirche, theologisch nicht mit Paulus einig, sondern die menschliche Mitwirkung zum Heil, den Synergismus lehrend, hatte es einst nicht gewagt, den Wortlaut der Bibel in ihrer lateinischen Übersetzung derart zu verändern.
Was an Römer 3, 27f. verdeutlicht wurde, lässt sich auch an vielen weiteren Übersetzungsbeispielen zeigen. Immer wieder ist der Bibeltext – von all den feministischen Ergänzungen und Veränderungen einmal abgesehen – geradezu willkürlich umgeschrieben.
Doch wer kann das noch beurteilen? Am Ende werden es nur Theologen und Theologinnen sein, die hebräisch und griechisch gelernt und daher die Möglichkeit haben, die „Bibel in gerechter Sprache“ am Urtext zu messen. Allen anderen Christen bleibt nicht anderes übrig, als den großen Ankündigungen und Versicherungen der Herausgeber und Übersetzerinnen zu vertrauen. In welchem Maß solch blindes Vertrauen bereits aufgebaut wurde, zeigt der in so manchen Diskussionen bisher laut gewordene Gegeneinwand, die neue Bibel könne, da doch so viele Bibelwissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, auch mit bekannten Namen, an ihr mitgearbeitet hätten, gar nicht falsch sein.
Luther wollte die Gemeinden mündig machen gegenüber einer kirchlichen Obrigkeit, die die zu glaubenden Lehrinhalte von oben vorschrieb. Daher sollte jeder Christ die Bibel lesen und verstehen können. Wenn nun heute diese Bibel selbst verändert und umgeschrieben wird, so ist gegen dieses Vorhaben auch um der Urteilsfähigkeit der Gemeinden willen entschiedener Widerspruch einzulegen.
Zusatz von mir: Der Rat der EKD hat am 31.3 2007 – in Übereinstimmung mit der Bischofskonferenz der VELKD vom 6. 3. – festgestellt: „Die `Bibel in gerechter Sprache´ eignet sich nach ihrem Charakter und ihrer sprachlichen Gestalt generell nicht für die Verwendung im Gottesdienst.“
Der Predigttext für den 13. Sonntag nach Trinitatis (2.September) steht im Evangelium des Matthäus, Kapitel 6, die Verse 1 – 4
Habt acht auf eure Frömmigkeit, dass ihr die nicht übt vor den Leuten, um von ihnen gesehen zu werden; ihr habt sonst keinen Lohn bei eurem Vater im Himmel.
Wenn du nun Almosen gibst, sollst du es nicht vor dir ausposaunen lassen, wie es die Heuchler tun in den Synagogen und auf den Gassen, damit sie von den Leuten gepriesen werden. Wahrlich ich sage euch: Sie haben ihren Lohn schon gehabt.
Wenn du aber Almosen gibst, so lass deine linke Hand nicht wissen, was die rechte tut, damit dein Almosen verborgen bleibe; und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird dir´s vergelten.
Der 13. Sonntag nach Trinitatis hat als zentrales Thema das der wahren Barmherzigkeit. In der Überschrift des sechsten Kapitels des Matthäusevangeliums, dem Mittelteil der Bergpredigt, steht der Ausdruck „Frömmigkeit“. Die eigentliche Übersetzung des entsprechenden griechischen Wortes ist „Gerechtigkeit“. Es geht um die Gerechtigkeit, d. h. die guten Werke des Menschen, unter denen das Matthäusevangelium besonders das Almosen geben, das Beten und das Fasten versteht. Gerechtigkeit ist so verstanden die Frömmigkeit, die sich in Barmherzigkeit, Gebet und Fasten darstellt. Die guten Werke sollen nach jüdischem Verständnis über das hinausgehen, was nach den jüdischen Religionsvorstellungen
gefordert ist. So kann der Fromme zusätzliche Verdienste erwerben, mit denen er Gesetzesübertretungen sühnen kann und sich im Jüngsten Gericht das Übermaß an guten Werken anrechnen lassen. Im Alten Testament finden wir die Vorstellung vom Zusammenhang von Tun und Ergehen. Wer Gerechtigkeit übt, der speichert sich Leben bei Gott und wer Unrecht tut, der verwirkt sich selbst sein Leben. Almosengeben (Beten, Fasten) ist also wie ein Schatz, der größer oder kleiner werden kann.
Zunächst wird man aber feststellen, dass das Judentum eine vorbildliche Armenfürsorge kannte, die durch Abgaben funktionierte, zu denen jeder Jude verpflichtet war. Unter anderem der Armenzehnt nach dem 5. Buch Mose, 14, 28: „Alle drei Jahre sollst du aussondern den ganzen Zehnten vom Ertrag dieses Jahres und sollst ihn hinterlegen in deiner Stadt. Dann soll kommen …. und die Waise und die Witwe, die in deiner Stadt leben, und sollen essen und sich sättigen, auf dass dich der Herr, dein Gott, segne in allen Werken deiner Hand.“
Der in Vers 2 verwendete Begriff „Heuchler“ ist ursprünglich als Bezeichnung für einen Schauspieler verwendet worden, der eine bestimmte Rolle spielt. Nicht Unehrlichkeit ist mit diesem Begriff gemeint, sondern das Aufzeigen des Selbstwiderspruchs, in den sich ein Mensch begibt, wenn er sich und anderen etwas vorspielt, was er nicht sein kann.
Der Heuchler erwartet mit seiner Wohltätigkeit beides. Ehre und Anerkennung durch die Mitmenschen und den himmlischen Lohn. Ein solcher Mensch hat seinen Lohn empfangen.
Der Satz von der linken Hand, die nicht wissen darf, was die rechte tut, ist ein Rätselwort. Es ist entsprechend dem Funktionieren unseres Zentralnervensystems nicht möglich, was von der Wahrnehmung der Hände gesagt wird. Die Wendung „dein Vater“ weist darauf hin, dass hier der Akt der Liebe Gottes gemeint ist, dessen radikal verborgenes Tun dem Menschen die Gerechtigkeit zukommen lässt, die er selbst nicht erwerben kann.
Der Predigttext für den sechsten Sonntag nach Trinitatis (15. Juli) steht im Buch des Propheten Jesaja, Kapitel 43, 1- 7
Und nun spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, und dich gemacht hat, Israel: Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst; ich habe dich bei deinem Namen gerufen; du bist mein. Wenn du durch Wasser gehst, will ich bei dir sein, dass dich die Ströme nicht ersäufen sollen, und wenn du ins Feuer gehst, sollst du nicht brennen, und die Flamme soll dich nicht versengen. Denn ich bin der Herr, dein Gott, der Heilige Israels, dein Heiland. Ich habe Ägypten für dich als Lösegeld gegeben. Kusch und Seba an deiner statt, weil du in meinen Augen so wert geachtet und auch herrlich bist und weil ich dich liebe habe. Ich gebe Menschen an deiner statt und Völker für dein Leben. So fürchte dich nun nicht, denn ich bin bei dir. Ich will vom Osten deine Kinder bringen und dich vom Westen her sammeln; ich will sagen zum Norden: Gib her! Und zum Süden: Halte nicht zurück! Bring her meine Söhne von ferne und meine Töchter vom Ende der Erde, alle, die mit meinem Namen genannt sind, die ich zu meiner Ehre geschaffen und zubereitet und gemacht habe.
Dieser Sonntag ist nach der Tradition des Kirchenjahres derjenige, an dem in den Texten und Liedern an die Taufe erinnert wird.
Der alttestamentliche Predigttext ist dem zweiten Jesajabuch (Deuterojesaja Kapitel 40 – 55)
entnommen, in dem der unbekannte Heilsprophet während der Endzeit des babylonischen Exils (587 – 538 vor Christus) seine Heilsbotschaft an die dort lebenden Volks- und Glaubensgenossen richtet. „Tröstet, tröstet mein Volk!, spricht euer Gott. Redet mit Jerusalem freundlich und predigt ihr, dass ihre Knechtschaft ein Ende hat.“ (Jesaja 40, 1f.)
„Und nun“ beginnt der als Einheit zu verstehende Predigtabschnitt. Deutlich ist zu spüren, dass der Prophet die „Wende“ in dem politischen Schicksal seinen Mitgefangenen ankündigt.
Nun schlägt eine neue Stunde. Die Heilszusage, wie wir sie in den Versen des Predigttextes vor uns haben, ist eine charakteristische Form der Botschaft des Deuterojesaja. Sie hat ihren Ursprung nicht in der prophetischen Rede, sondern im jüdischen Gottesdienst. Dem zu Gott flehenden werden durch einen Priester Worte der Gewissheit zugesagt. Diese priesterliche Verkündigung nimmt Deuterojesaja auf. Die in die babylonische Verbannung gebrachten Menschen des jüdischen Volkes hatten im Blick auf ihr Schicksal die Hände flehend zu Gott erhoben und auf ein Wort der Gnade und Tröstung gewartet. Die Klage des Einzelnen und das tröstende Wort des Priesters im Gottesdienst werden nun zur Klage des Volkes und der Heilszusage an dieses. Ihm gilt die Heilszusage „Fürchte dich nicht“.
Damit geschieht Neues. Die Botschaft des Deuterojesaja an sein Volk bekommt einen persönlichen Klang. Die Aussage „ich habe dich erlöst“, entstammt dem Familienrecht und bezeichnet das Freikaufen eines in Schuldhaft geratenen Verwandten. Die Anwendung der ursprünglich auf den Einzelnen bestimmten Heilszusage auf das Volk und sein Schicksal wird dadurch möglich, dass es schon in der „Väterzeit“ eine Epoche gegeben hatte, die von einem persönlichen Gottesverhältnis bestimmt war. (Fürchte dich nicht, Abraham. 1. Mose, 15,1)
Nicht nur mit dem Volk Israel hat Gott seine Geschichte, sondern jeder Einzelne darf sich als Geschöpf Gottes verstehen.
In Vers 3 wird deutlich, dass das Zentrum der alttestamentlichen Theologie darin besteht, dass das Verhältnis zwischen Gott und Mensch vom Miteinander und Gegeneinander des Handelns und Seins bestimmt ist.
In den Versen 3b – 4b wird deutlich, dass der Heiland Israels der Herr der Völker ist. In der Mitte dieser beiden Verse steht das so bedeutende Wort von der „Erwählung Israels“. Der Herr aller Mächte hat diese kleine und unbedeutende Gruppe entwurzelter Menschen auserwählt. Diese Zuwendung ist das Fundament, auf dem die Verkündigung des Propheten aufbaut.
Die Verse 5 – 7 sind in den Aussagen und dem Aufbau dem ersten Teil ähnlich, wenn auch kürzer. Das Ziel der Zuwendung Gottes und seines Erlösungswerkes ist nicht die Erhöhung Israels, sondern geschieht zur Ehre Gottes. Dieser Sonntag ist dem Gedächtnis der Taufe gewidmet.
Der Predigttext für den fünften Sonntag nach Trinitatis (8. Juli) steht im Evangelium des Lukas, Kapitel 14, die Verse 25 – 35
Es ging aber eine große Menge mit ihm; und er wandte sich um und sprach zu ihnen: Wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater, Mutter, Frau, Kinder, Brüder, Schwestern und dazu sich selbst, der kann nicht mein Jünger sein. Und wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachfolgt, der kann nicht mein Jünger sein.
Denn wer ist unter euch, der einen Turm bauen will und setzt sich nicht vorher hin und überschlägt die Kosten, ob er genug habe, um es auszuführen, damit nicht, wenn er den Grund gelegt hat und kann´s nicht ausführen, alle, die es sehen, anfangen, über ihn zu spotten, und sagen: Dieser Mensch hat angefangen zu bauen und kann´s nicht ausführen?
Oder welcher König will sich auf einen Krieg einlassen gegen einen andern König und setzt sich nicht zuvor hin und hält Rat, ob er mit zehntausend dem begegnen kann, der über ihn kommt mit zwanzigtausend? Wenn nicht, so schickt er eine Gesandtschaft, solange jener noch fern ist, und bittet ihn um Frieden.
So auch jeder unter euch, der sich nicht lossagt von allem, was er hat, der kann nicht mein Jünger sein.
Das Salz ist etwas Gutes; wenn aber das Salz nicht mehr salzt, womit soll man würzen? Es ist weder für den Acker noch für den Mist zu gebrauchen, sondern man wird´s wegwerfen.
Wer Ohren hat zu hören, der höre!
Dieser fünfte Sonntag nach Trinitatis hat als Thema das der Nachfolge Jesu Christi.
Mit den Versen 57- 62 des neunten Kapitels hatte Lukas den Abschnitt seines Evangeliums begonnen, in denen er den Jüngern, die eine Missionstätigkeit beginnen sollten, den Ernst der Nachfolge einschärfen sollte. Betrachtet man die in dem Abschnitt 10, 1 – 14, 24 stehenden Texte, dann fällt auf, dass sie einen bestimmten Rhythmus wiedergeben. Jesus ist zu Gast bei Menschen, dann wandert er weiter. So ist der Predigttext einer Phase des Wanderns zwischen zwei Ruhepausen zugeordnet. In den Texten, in denen Ruhepausen vorkommen, wird von Menschen berichtet, die sich auf den Weg machen. In unserem Text wendet er sich Menschen zu, um sie zum Innehalten aufzufordern. Jesus fordert mit seinen Worten dazu auf, sich den Schritt in die Nachfolge gründlich zu überlegen.
Menschen folgen Jesus nach. Sie werden damit konfrontiert, dass sie ihre Familie und sich selbst „hassen“ sollen. Hierbei handelt es sich nicht um eine emotionale Befindlichkeit, sondern um eine Distanzierung von der eigenen Person, wie es auch das erste Gebot fordert.
Vergleicht man den Lukastext mit dem des Matthäusevangeliums, so fällt eine deutliche Verschärfung bei Lukas auf. Er will seine Leser erschrecken, aufhalten und warnen.
Die beiden im Text stehenden Gleichnisse zielen auf das Thema der Beschämung. Der Bauer, der auf seinem Grundstück einen Wach- oder Lagerturm bauen will, der König eine mögliche Niederlage abwendet, wollen nicht zum Gespött der Leute werden. Darauf legt es
Der Predigttext zum dritten Sonntag nach Trinitatis (24. 6.) steht im Evangelium des Lukas, Kapitel 19, die Verse 1 – 10
Und er ging nach Jericho hinein und zog hindurch. Und siehe, da war ein Mann mit Namen Zachäus, der war ein Oberer der Zöllner und war sehr reich.
Und er begehrte Jesus zu sehen, wer er wäre, und konnte es nicht wegen der Menge; denn er war klein von Gestalt.
Und er lief voraus und stieg auf einen Maulbeerbaum, um ihn zu sehen; denn dort sollte er durchkommen.
Und als Jesus an die Stelle kam, sah er auf und sprach zu ihm: Zachäus, steig eilend herunter; denn ich muss heute in deinem Hause einkehren. Und er ging nach Jericho hinein und zog hindurch. Und siehe, da war ein Mann mit Namen
Und er stieg eilend herunter und nahm ihn auf mit Freuden.
Als sie das sahen, murrten sie alle und sprachen: Bei einem Sünder ist er eingekehrt. Zachäus aber trat vor den Herrn und sprach: Siehe, Herr, die Hälfte von meinem Besitz gebe ich den Armen, und wenn ich jemanden betrogen habe, so gebe ich es vierfach zurück.
Jesus aber sprach zu ihm: Heute ist diesem Hause Heil widerfahren, denn auch er ist Abrahams Sohn.
Denn der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist.
Das Thema der für den dritten Sonntag nach Trinitatis vorgesehenen Lesungen und des Predigttextes ist die Annahme der Sünder.
Mit der nur im Evangelium des Lukas zu findenden Zachäuserzählung wird das Augenmerk auf eine in der Zeit Jesu besonders verachtete Berufsgruppe gerichtet. Schon die seit Alexander des Großen bestehende Besatzungspolitik vergab die alljährliche Steuer- und Abgabenverpachtung an Privatleute. Dieses Verfahren wurde von den Römern übernommen und fortgeführt. So verpachtete für das Gebiet von Galiläa der Landesfürst Herodes Antipas das Recht zur Erhebung von Steuern gegen Vorkasse an einen Unternehmer. Dabei wurde von einer geschätzten Summe ausgegangen. Der Unternehmer wiederum verpachtete das Recht an Subunternehmer, wobei der Ertrag wiederum geschätzt wurde. Dies ließ den Unternehmern eine gewisse Kalkulationsspanne und führte in der Regel zu ungerechten und überhöhten Steuerforderungen.
Besonders verachtet waren diese Zolleinnehmer in der jüdischen Gesellschaft bei den Gruppen, die durch eine genaue Auslegung der Tora die Heiligung des Alltages als zentrales Anliegen betrachteten. Nach rabbinischer Überzeugung führten die Zolleinnehmer einen
unehrenhaften Beruf aus. Die Sozialkontakte mit diesen wurden auf das unumgängliche Mindestmaß beschränkt.
Die Zachäuserzählung ist in zwei Szenen gegliedert. Die erste Szene spielt auf der Straße (1 – 6); die zweite im Hause des Zachäus mit überwiegend wörtlichen Reden. (7 -10). Bei der Beachtung des gesamten lukanischen Evangelientextes sind vier Momente in diesem Text zu finden. Annahme der Sünder; der richtige Umgang mit Gütern; Abrahamskindschaft und Einladungen.
Der Name Zachäus dürfte mit „der Gerechte“ zu übersetzen sein. Seine Funktion ist die eines Oberaufsehers über das Zollwesen. Er mag deswegen ein gefürchteter Mann gewesen sein, geachtet wird er nicht. Das Volk versperrt ihm, dem körperlich kleinen Mann, den Blick auf Jesus. Seine gedankliche und körperliche Beweglichkeit wird darin deutlich, dass er „vorauseiland“ sich nicht zu schade ist, auf einen Baum zu steigen.
Ab Vers 5 übernimmt Jesus die Initiative, die er bis zum Schluss der Erzählung nicht mehr abgibt.
Jesus sieht den Zachäus, er redet ihn mit Namen an, er weist Zachäus an herabzusteigen und ihn als Gast aufzunehmen. Diese Initiative Jesu bringt Zachäus zu einer Lebensbeichte, die dem Murren der Menschen widerspricht. Die Folge seiner Beichte besteht darin, dass er sein falsches Handeln über die geltenden Vorschriften hinaus korrigiert.
Auf dieses Verhalten hin spricht Jesus ihm und seiner Hausgemeinschaft das Heil und die Rettung zu.
Diese Rettung erreicht Zachäus, weil Jesus sucht und rettet. Ab Kapitel, Vers 1 geht es Lukas um die Annahme der Sünder und die Gemeinschaft mit ihnen. Jesus, der Menschensohn, sucht diese Gemeinschaft zur Rettung der Menschen.
Predigttext für den ersten Sonntag nach Trinitatis aus dem Evangelium des Matthäus, Kapitel 9, 35 – 38; Kapitel 10, 1 und 5 – 7
Und Jesus ging ringsum in alle Städte und Dörfer, lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium von dem Reich und heilte alle Krankheiten und Gebrechen. Und als er das Volk sah, jammerte es ihn, denn sie waren verschmachtet und zerstreut wie die Schafe, die keinen Hirten haben. Da sprach er zu seinen Jüngern: Die Ernte ist groß, aber wenige sind der Arbeiter. Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sende.
Und er rief seine zwölf Jünger zu sich und gab ihnen Macht über die unreinen Geister, dass sie die austrieben und heilten alle Krankheiten und Gebrechen.
Diese Zwölf sandte Jesus aus, gebot ihnen und sprach: Geht nicht den Weg zu den Heiden und zieht in keine Stadt der Samariter, sondern geht hin zu den verlorenen Schafen aus dem Haus Israel. Geht aber und predigt und sprecht: Das Himmelreich ist nahe herbeigekommen.
Die nun nur noch numerisch gezählten Sonntage nach dem Trinitatisfest sind thematisch bestimmt. In den Lesungen und dem Predigttext des ersten Sonntages geht es um das Thema Gottes- und Bruderliebe.
Der erste Vers des Predigttextes wiederholt mit der dreifachen Tätigkeit Jesu „lehren, verkündigen, heilen“ den Vers 23 des vierten Kapitels des Evangeliums. Zwischen diesem, der Jesu Wirken in Galiläa lokalisiert und dem Vers 35 des neunten Kapitels befinden sich die Bergpredigt, die Taten in Kapernaum und der Stillung des Sturmes. In diesen Texten, in denen Heilungs- und Berufungsgeschichten im Vordergrund stehen, zeigt sich Jesus als der Messias, der Gottgesandte der Tat.
Das Bild von der verlassenen Herde begegnet als immer wieder kehrendes Bild in der Bibel. Bei dem Vers 36 wird auf die alttestamentliche Stelle im 1. Buch der Könige, Kapitel 22 hingewiesen. Der Prophet Micha ben Jimla stellt sich mit seiner Prophezeiung gegen die Weissagung der Hofpropheten. Micha sieht einen Feldzug seines Königs scheitern und damit das Volk seines Regenten beraubt und dieses wie Schafe ohne Hirten umherirren. So mag die soziale Situation der Menschen zu der Zeit Jesu – besonders in Galiläa- gewesen sein. Die römische Besatzungsmacht saugt über die ihr hörigen Verwalter die hart arbeitenden Menschen bis zum Letzten aus.
Die große Not der Menschen ist aber nach dem damaligen Verständnis vom Ablauf der Weltgeschichte ein Hinweis darauf, dass nun Gottes Zeit, seine Ernte beginnt. Nach Kapitel 13, 41 sind es die Engel Gottes, die im Bild der Ernte als Vollzieher des Gerichtes erscheinen.
In unserem Predigttext sind es Menschen, die schon auf der Erde Gottes Ernte einsammeln, denn da, wo Gottes Wort verkündigt wird, vollziehen sich die Entscheidungen des Jüngsten Gerichtes. „Das Himmelreich“ ist in der Predigt, der Annahme der Predigt und der Heilung durch Jesus gegenwärtig.
Aus dem großen Kreis seiner Anhänger werden zwölf als bevollmächtigte Sendboten eingesetzt. In der Liste der Namen – die in dem oben stehenden Text ausgelassen sind – finden sich Menschen ausschießlich aus Galiläa. Es sind Fischer und Zöllner und Sozialrevolutionäre, die in diesem Kreis namentlich genannt werden. Die Einsetzung der zwölf ist eine programmatische Tat. Sie sollen die zwölf Stämme des Volkes Israel repräsentieren. Nach der Auffassung zu der Zeit Jesu gab es nur noch zweieinhalb Stämme. (Juda, Benjamin und die Hälfte des Stammes Levi. Die anderen Stämme waren seit der Eroberung des Nordreiches im Jahre 722 vor Christus nicht mehr vorhanden.) So war die Vorstellung, dass erst mit dem Anbruch der Heilszeit Gottes das Zwölfstämmevolk wieder hergestellt werde. Die Zwölfzahl der Apostel aber weist darauf hin, dass nun das zukünftige Gottesvolk entsteht, zu dem nach Jesu Erwartung auch die Nichtjuden gehören.
Das Wirkungsgebiet wird auf die „verlorenen Schafe aus dem Haus Israel“ begrenzt. Diese Aussage dürfte der ansonsten positiven Einstellung zu den Samaritern und dem am
Ende des Evangeliums stehenden Missionsbefehl widersprechen.
Ich schließe mich der Auffassung an, dass wir in diesem Text ursprüngliche Jesusüberlieferung finden. Jesus habe seine Tätigkeit und die seiner Jünger auf Israel begrenzt. Nach dem Text Kapitel 8, Vers 11 erwartet Jesus bei der Völkerwallfahrt zuerst die Kinder des Reichs, die im Himmelreich mit Abraham, Isaak und Jakob zu Tisch sitzen, schließt aber die Bekehrung der Nichtjuden nicht aus. Nach dem alttestamentlichen Text aus Hesekiel, Kapitel 34 findet sich dort die Weisung an den von Gott gesandten „Hirten“, die verlorenen Angehörigen des jüdischen Volkes zurecht zu bringen und zu heilen. Dies war sicher auch die Erwartung der ersten christlichen Gemeinden. Sie erwarteten, dass zuerst das jüdische Volk den Messias anerkennt. In der Apostelgeschichte und den paulinischen Schriften wird dies noch darin deutlich, dass Paulus zunächst in den Synagogen und erst danach sich den Nichtjuden zuwendet.
Predigttext für den Sonntag Trinitatis (3. Juni) aus dem Buch Numeri – 4. Buch Mose, Kapitel 6, die Verse 27
Und der Herr redete mit Mose und sprach:
Sage Aaron und seinen Söhnen und sprich:
So sollt ihr sagen zu den Israeliten, wenn ihr sie segnet:
Der Herr segne dich und behüte dich;
der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig;
der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden.
Denn ihr sollt meinen Namen auf die Israeliten legen, dass ich sie segne.
Mit dem Trinitatis – oder Dreifaltigkeitssonntag beginnt die zweite Hälfte des Kirchenjahres.
Die Sonntage werden numerisch weitergezählt. Da die Zahl dieser Sonntage von dem jeweiligen Ostertermin abhängen, kann man sie inhaltlich dem Osterfestkreis zuordnen.
An diesem Sonntag wird ein Thema des christlichen Glaubens in den Mittelpunkt der gottesdienstlichen Texte zu stellen. Schon im dritten und vierten Jahrhundert nach Christus bestand das Bedürfnis, das Glaubensgeheimnis der Dreieinigkeit Gottes gottesdienstlich zu feiern. In diese Zeit fallen die Auseinandersetzungen um die Gottheit Christi und die Abwehr des germanischen Arianismus. Arius ( 280 – 336) vertrat die Auffassung, dass Christus Gott nicht gleichgestellt und wesensgleich, sondern von Gott geschaffen und ihm untergeordnet sei. Diese Lehre fand bei den germanischen Volksgruppen der Goten, Vandalen und Langobarden einen gewissen Einfluss und bewegte breite Schichten der Kirchenmitglieder. Nach langen und intensiven theologischen Auseinandersetzungen, die auch zu einem neuen theologischen Bewusstsein in der Christenheit führten, wurde die Lehre des Arius abgewiesen. Die Lehre von der Dreieinigkeit Gottes wurde zum zentralen Glaubensinhalt (Dogma) der christlichen Lehre.
Mitte des achten nachchristlichen Jahrhunderts gibt es Hinweise auf eine gottesdienstliche Feier dieses Themas; 1334 wird das Trinitatisfest verbindlich eingeführt.
Mit der Einordnung dieses Festes nach den drei großen Kirchenfesten Weihnachten, Ostern und Pfingsten setzt es den Schlusspunkt unter deren Bedeutung. Weihnachten = Werk des Vaters, Ostern = Werk des Sohnes; Pfingsten = Werk des Hl. Geistes.
Der aaronitische Segen ist der Predigttext für diesen Sonntag. Nach der Tradition unserer Kirche wird mit ihm der Gottesdienst abgeschlossen. Es wäre zu kurz gedacht, wenn die dreifache Nennung des Gottesnamens der Grund dafür wäre, diesen Segen mit dem Thema dieses Sonntages zu verbinden. Der christlichen Gemeinde erschließt sich dieser alttestamentliche Segen dreifach: Gott schenkt als Schöpfer der Welt allem Lebendigen Anteil an seinem Segen; durch Christus hat er die Abrahamsverheißung universell werden lassen und durch den Heiligen Geist hat sich Gott den Jüngern so wie Mose am Berg Sinai erschlossen.
Der Predigttext aus dem 4. Buch Mose gehört in den Erzählungszusammenhang der Wanderung des Volkes Israel. Der Sinai, der Gottesberg, soll nach der Gottesbegegnung verlassen werden. Der Weg durch die Wüste wird fortgesetzt. Wie würde das Volk die Nähe Gottes auf diesem Weg erfahren. Die Stiftshütte, ein transportables Heiligtum wird gebaut (2. Buch Mose, 25- 31; 35 – 40) Ein wandernder „Sinai“ begleitet nun das Volk.
Der Segen ist ein Wortgeschehen. Gottes Ort in dieser Welt ist auch sein Wort. Der aaronitische Segen ist also ein Abschieds- und Reisesegen.
Die kunstvoll poetische Sprache und Struktur des Segens erinnert an eine höfische Audienzszene. Wie ein königlicher Wesir bittet ein Priester Gott um Zuwendung.
In Vers 24 wird die Begegnung durch den Gruß eingeleitet, der die Begegnung von Gott und Mensch unter den persönlichen Schutz Gottes stellt.
In Vers 25 wird der Wunsch zum Ausdruck gebracht, dass die wärmende und freundliche Zuwendung zu einer gnädigen und barmherzigen Aufnahme der Anliegen des Bittstellers führen möge.
In Vers 26 wird die Bitte geäußert, Gott möge dem Bittsteller wohl gesonnen sein; ihn also in den Bereich des Friedens einlassen.
Das Ziel jeder Gottesbegegnung, das mit diesem Segen formuliert wird, ist die Aufnahme in eine umfassende Friedensordnung.
Predigttext für den Pfingstsonntag aus dem 4. Buch Mose, Kapitel 11, die Verse 11 und 12; 14 – 17 und 24 – 25
Und Mose sprach zu dem Herrn: Warum bekümmerst du deinen Knecht? Und warum finde ich keine Gnade vor deinen Augen, dass du mir die Last dieses ganzen Volkes auf mich legst?
Hab ich denn all das Volk empfangen oder geboren, dass du zu mir sagen könntest: Trag es in deinen Armen, wie eine Amme ein Kind trägt, in das Land, das du ihren Vätern zugeschworen hast?
Ich vermag all das Volk nicht allein zu tragen, denn es ist mir zu schwer. Willst du aber doch so mit mir tun, so töte mich lieber, wenn anders ich Gnade vor deinen Augen gefunden habe, damit ich nicht mein Unglück sehen muss. Und der Herr sprach zu Mose: Sammle mir siebzig Männer unter den Ältesten Israels, von denen du weißt, dass sie Älteste im Volk und Amtsleute sind, und bringe sie vor die Stiftshütte und stelle sie dort vor dich, so will ich herniederkommen und dort mit dir reden und von deinem Geist, der auf dir ist, nehmen und auf sie legen, damit sie mit dir die Last des Volks tragen und du nicht allein tragen musst.
Und Mose ging heraus und sagt dem Volk die Worte des Herrn und versammelte siebzig Männer aus den Ältesten des Volkes und stellte sie rings um die Stiftshütte. Da kam der Herr hernieder in der Wolke und redete mit ihm und nahm von dem Geist, der auf ihm war, und legte ihn auf die siebzig Ältesten. Und als der Geist auf ihnen ruhte, gerieten sie in Verzückung wie Propheten und hörten nicht auf.
Auf den ersten Blick ist der vorgesehene Predigttext für den Pfingstsonntag sehr ungewöhnlich. Es ist ein Abschnitt aus dem 4. Buch Mose, dem Buch Numeri, wie es lateinisch heißt. Es ist ein Teil der fünf Bücher Mose, dessen Inhalt weitestgehend unbekannt ist. Einen inhaltlichen Zusammenhang zwischen dem Text des Alten Testamentes und dem Pfingstfest stellt das Glaubensbekenntnis von Nizäa-Konstantinopel (in unserem Gesangbuch unter der Nummer 805 zu finden) her, wenn es dort im dritten Teil heißt: Wir glauben an den Heiligen Geist …. der gesprochen hat durch die Propheten. Hier bekennt die gesamte Christenheit seit dem 4. Jahrhundert, dass der Heilige Geist nicht erst seit Pfingsten oder bei der Taufe Jesu geschehen, sondern das Alte Testament voller Zeugnisse durch diesen ist.
Nach dem Bericht der Apostelgeschichte Kapitel 2, 1ff. sind die Jünger Jesu am 50. Tag nach Ostern in Jerusalem versammelt. Sie empfangen zur dritten Stunde des Tages, also um 9 Uhr die Geistesgabe, in anderen Sprachen zu reden. Mit der Rede des Petrus, in der er auf die Verheißung des Geistes durch den Propheten Joel, Kapitel 3, 1ff. hinweist und der Verkündigung von Tod und Auferstehung Jesu Christi wird dieser Tag zum Gründungstag der christlichen Kirche.
Nach den 50 Tagen der intensiven Gemeinschaft mit dem auferstandenen Christus wird nun deutlich, in welcher Weise dieser künftig unter den Glaubenden erscheint. Die die Jünger ergreifende Kraft ist Ausdruck des neuen Lebens. Die Geschichte des Auferstandenen setzt sich somit in der Glaubensgeschichte des Volkes Gottes und jedes Einzelnen fort. Sie vollzieht sich in den unterschiedlichsten Situationen und Sprachwelten.
Das Buch Numeri (4. Buch Mose) hat seinen Namen „Zahlen“ nach der in den ersten vier Kapiteln dokumentierten Volkszählung. Die Lektüre des Buches ist dadurch erschwert, dass unterschiedlichste Teile in undurchsichtiger Weise einander folgen. „Der Gang der Geschichte wird überall gehemmt durch eingeschaltete zahllose Gesetze.“
Vermutlich ist dieses Buch in der Zeit des babylonischen Exils (587 – 515 vor Christus) entstanden. Erzählende und gesetzliche Überlieferungen wurden in dieser Zeit aktualisiert.
Für den Predigttext sind die Verse des 11.Kapitels ausgewählt, die zu der Geistverteilungserzählung gehören. Die kunstvoll eingefügte Wachtelwundererzählung ist aus inhaltlichen Gründen weggelassen worden.
Der Text kann in zwei Schritten betrachtet werden. Erster Schritt: Mose macht Gott Vorwürfe. Mose fühlt sich als der von Gott Beauftragte schlecht behandelt. So ist er von ihm entfremdet und seine Beziehung zu seinem Volk ist zerrüttet. Mit auffallend weiblichen Bildern erinnert er Gott an seine Pflichten. Er wünscht sich die Gnade des Todes.
Gott spricht zu Mose. Er gibt ihm einen dreifachen Auftrag. Versammle, bringe sie und stelle hin. Inmitten des wartenden Volkes befindet sich Mose, der Anführer, damit sein zerrüttetes Verhältnis zu seinem Volk geheilt wird. Das Gegenprogramm Gottes führt dazu, dass die Einsamkeit des Mose beseitigt wird. 70 Älteste, die Ansehen im Volke haben und auf die er sich verlassen kann, übernehmen mit ihm die Verantwortung. Der Geist Gottes, der auf sie kommt, kommt nicht von Gott, sondern der dem Mose gegebene Geist wird auf die Ältesten verteilt.
Die Führungskrise des Mose ist seine selbst gemachte Einsamkeit, in die er durch seinen autokratischen Führungsstil geraten ist. Die Aufgabe aber muss – so will es Gott – auf mehrere Schultern verteilt werden. Von der Autokratie zur Aristokratie. Die 70 sind mit den gleichen Führungsqualitäten begabt wie Mose.
Die Geistbegabung hat den Mose nicht vor einer Krise bewahrt. Seine Geistbegabung aber hat ihn durch die Krise zu neuen Erkenntnissen und Handlungsweisen geführt.
Der Predigttext für den Sonntag Exaudi (20. Mai) aus dem Evangelium des Johannes, Kapitel 14, die Verse 15 – 21
Liebt ihr mich, so werdet ihr meine Gebote halten. Und ich will den Vater bitten und er wird euch einen anderen Tröster geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit: den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie sieht ihn nicht und kennt ihn nicht. Ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein.
Ich will euch nicht als Waisen zurücklassen; ich komme zu euch. Es ist noch eine kleine Zeit, dann wird mich die Welt nicht mehr sehen. Ihr aber sollt mich sehen, denn ich lebe und ihr sollt auch leben. An jenem Tage werdet ihr erkennen, das ich in meinem Vater bin und ihr in mir und ich in euch. Wer meine Gebote hat und hält sie, der ist´s, der mich liebt. Wer mich aber liebt, der wird von meinem Vater geliebt werden, und ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren.
Der siebente Sonntag der Osterzeit trägt den Namen Exaudi = Höre, Herr. Die Lesungen und der Predigttext nehmen das Thema des Abschiedes Jesu von der Erde und die Ankündigung des Geistes Gottes auf.
Der Predigttext ist ein Abschnitt aus der ersten Abschiedsrede Jesu, die von Kapitel 13, 31 – Kapitel 14, 31 reicht. Weitere folgen in den Kapiteln 15 und 16.
Der Inhalt des Johannesevangeliums gibt wenig Hinweise darauf, in welcher geschichtlichen Situation die christliche Gemeinde war, die der Verfasser des Evangeliums vor Augen hatte.
Sicher ist, dass der Verfasser an Christen geschrieben hat, um ihr Verständnis für die Jesusgeschichte zu vertiefen. Die Kenntnis der Geschichte Jesu wird beim Leser vorausgesetzt. An ihm und seiner Geschichte orientiert sich der christliche Glaube. Nach Kapitel 1, Vers 14 „wohnte das Fleisch unter uns“. Nun geht diese Zeit zu Ende. Kapitel 13, 31ff. schlägt nach dem Weggang des Judas nach dem Abendmahl die Stunde des Abschieds und der Verherrlichung Jesu. Seine Jünger werden zurückgelassen. Selbst Petrus vermag Jesus nicht zu folgen. Er verleugnet ihn.
An dem Sonntag Exaudi, dem Sonntag zwischen Himmelfahrt und Pfingsten wird auch eine historische Frage aufgeworfen, die sich durch die Verleugnung des Petrus und die damit verbundene Verknüpfung der Abschiedsreden im Johannesevangelium stellt. Wenn der Gehorsam der Jünger zur Anerkennung des Leidens Jesu fehlt, wer oder was ist dann der Grund des Glaubens? Bleiben da Menschen nach dem Tode Jesu zurück, die mit einem gebrochenen Verhältnis zu ihrer jüdischen Umwelt, ohne Rangordnung, Gemeindeaufbau und keinem Verhältnis zu den existierenden sozialen und politischen Mächten eine Zukunft versuchen?
Es dürfte aus der heutigen Sicht einem Wunder gleichen, dass die ersten Christengemeinden mit ihrer unterschiedlichen theologischen Ausprägung nicht auseinander liefen, sondern immer wieder zur Einheit zusammenfanden. Diese Einheit ist darin zu sehen, dass der Glaube an Jesus Christus in ihm seinen historische und inhaltliche Ursache und Wirkung hat.
In Vers 16 unseres Predigttextes ist zum ersten Mal von dem „Parakleten“ die Rede. Die Übersetzung lautet „ der zur Hilfe Herbeigerufene, der Fürsprecher, der Helfer, der Wegführer; seltener der Tröster. Die Hauptbedeutung dieses griechischen Wortes ist „Rechtsbeistand“. In unserem Text wird er als der Geist der Wahrheit bezeichnet. Dieser Geist der Wahrheit wird an die Person Jesu gebunden. Die göttliche Kraft des Geistes wirkt Ungewöhnliches. Er erinnert an die Worte Jesu. Sie sollen in dem Sinne verstanden, aufgenommen und weitergegeben werden, wie es in Vers 19 heißt: Ich lebe und ihr sollt auch leben.
Der Predigttext für Christi Himmelfahrt (17. Mai) steht im Evangelium des Johannes, Kapitel 17, die Verse 20 – 26
Ich bitte aber nicht allein für sie, sondern auch für die, die durch ihr Wort an mich glauben werden, damit sie alle eins seien. Wie du, Vater, in mir bist und ich in dir, so sollen auch sie in uns eins sein, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast.
Und ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast, damit sie eins seien, wie wir eins sind, ich in ihnen und du in mir, damit sie vollkommen eins seien und die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast und sie liebst, wie du mich liebst.
Vater, ich will, dass, wo ich bin, auch die bei mir seien, die du mir gegeben hast; damit sie meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast; denn du hast mich geliebt, ehe der Grund der Welt gelegt war.
Gerechter Vater, die Welt kennt dich nicht; ich aber kenne dich und diese haben erkannt, dass du mich gesandt hast. Und ich habe ihnen deinen Namen kundgetan, damit die Liebe, mit der du mich liebst, in ihnen sei und ich in ihnen.
Der Himmelfahrtstag ist als eigener Festtag erst sehr spät in der christlichen Kirche entstanden. Erst zum Ende des vierten Jahrhunderts beginnt man, das ursprünglich im Umfeld der Osterwoche begangenen Gedächtnis der Erhöhung Christi entsprechend der im Lukasevangelium stehenden Zeitabfolge am 40. Tag nach Ostern zu begehen. Heute ist das religiöse Bewusstsein für diesen Tag fast vollkommen verschwunden, weil der moderne Mensch den „Himmel“ mit den Mitteln der Wissenschaft und Technik zu erobern sucht.
Der Predigttext ist ein Abschnitt aus dem großen Abschiedsgebet Jesu (Kapitel 17), das vor der Passionsgeschichte steht. In den in den Kapitels 14 – 16 stehenden Abschiedsreden Jesu finden sich inhaltliche Anklänge an das Abschiedsgebet, das in den Bibelüberschriften als „hohepriesterliches“ Gebet bezeichnet wird.
In der Anordnung dieses Gebetes im Johannesevangelium dürfte es eine ähnliche Funktion haben wie das Gebet Jesu im Garten Gethsemane. Inhaltlich betont aber dieses Gebet den Gehorsam Jesu gegenüber dem Vater. Jesu Tod ist das Mittel, durch den die Herrlichkeit Gottes offenbar wird. Diese Herrlichkeit Gottes wird sichtbar in der Erwählung der Jünger, der Offenbarung Gottes in der Person Jesu, die Sendung der Jünger in die Welt und schließlich ihre Einheit in der Liebe.
In den Versen 20 – 26 haben wir den dritten und vierten Teil des Kapitels 17 vor uns.
Der Gesichtskreis des Gebetes wird auf die spätere Generation von Glaubenden ausgeweitet, die von dem Wort der Apostel abhängen. Die Betonung der Einheit in Vers 21 dürfte darauf hinweisen, dass diese zur Zeit der Abfassung des Evangeliums zu Beginn des zweiten Jahrhunderts bereits problematisch geworden war. Das Evangelium ruft aber nicht zur institutionellen Einheit der Kirche auf, sondern meint die Einmütigkeit. Sie ist analog zu der Einheit des Vaters und des Sohnes. Der Vater ist in dem Sohn aktiv – dieser vollzieht seine Werke. Kraft dieser Einheit ist Jesus der Offenbarer, aus der heraus sich die Einheit der Gemeinde versteht. Die Einheit der Kirche entsteht durch die, „die durch ihr Wort an mich glauben werden. (Vers 20) Sie, die Einheit, wird nicht durch Organisationen, Institutionen und Dogmen hergestellt, sondern in der Praxis der Liebe der Jünger untereinander ist sie zu erkennen.
Jesus bittet, dass die Jünger und deren Nachfolger von der Welt- und Menschenliebe Gottes bewegt sind und diese unter ihnen gegenwärtig ist.
Der Predigttext für den Sonntag Rogate (13. Mai) steht im Evangelium des Matthäus, Kapitel 6, die Verse 7 – 13
Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht plappern wie die Heiden; denn sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Darum sollt ihr ihnen nicht gleichen. Denn euer Vater weiß, was ihr bedürft, bevor ihr ihn bittet. Darum sollt ihr so beten:
Unser Vater im Himmel!
Dein Name werde geheiligt.
Dein Reich komme.
Dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden.
Unser tägliches Brot gib uns heute.
Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsern Schuldigern.
Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen.
Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Der Name des Sonntages Rogate = Betet! hat seinen Namen von den im vierten Jahrhundert nach Christus eingeführten Bittprozessionen. Diese dienten dazu, nichtchristliche Flurbezeichnungen und die damit verbundenen Feldbegehungen abzuwehren. Im öffentlichen Bewusstsein haben sich diese für das Wachsen der Früchte durchgeführten Bitttage an manchen Orten erhalten. Im evangelischen Bewusstsein ist dieser Sonntag durch das Thema Gebet bestimmt.
In der fünften Predigtreihe ist das in der Bergpredigt des Matthäusevangeliums stehende Vater unser der Predigttext. Schon in den ersten zwei Jahrhunderten der christlichen Kirche wurde es als „Zusammenfassung der himmlischen Lehre“ oder als „Kurzfassung des ganzen Evangeliums“ verstanden. Ohne Beispiel und auch für unsere Zeit noch herausragend in Sprache und Inhalt sind die Erklärungen Martin Luthers zum Vater unser. (In unserem Gesangbuch unter der Nummer 806.3 zu finden.)
Der Text des so genannten Herrengebetes findet sich im Matthäus- und Lukasevangelium, wobei sich im Gebrauch der des Matthäusevangeliums schon sehr früh durchgesetzt hat.
Bei Matthäus steht das Gebet im Zusammenhang der Bergpredigt.
Von seinen Wurzeln her ist das Gebet ein jüdisches Gebet. Im 18-Bittengebet des Judentums finden sich ähnliche Formulierungen, wenn es dort in sechsten Bitte heißt: Vergib uns, unser Vater, denn wir haben gesündigt; verzeihe uns, unser König, denn wir haben gefrevelt. Du vergibst und verzeihest ja gerne.
Als christliches Gebet ist es deswegen anzusehen, weil Jesus Christus als der Sohn Gottes seine Jünger und damit seine Gemeinde lehrt, wie sie beten soll.
Die Matthäusfassung wurde schon ab dem zweiten Jahrhundert das Gebet des Einzelnen wie auch der Gemeinde. Außerhalb des Gottesdienstes sollte es dreimal (um neun, zwölf und fünfzehn Uhr) mit erhobenen und ausgebreiteten Armen, um so Christus am Kreuz nachzubilden, gebetet werden. Bei der damals üblichen Erwachsenentaufe in der Osternacht erfolgte die feierliche Übergabe von Glaubensbekenntnis, Evangelium und Vater unser. Bei der Taufe sprach der Täufling das Gebet zum ersten Mal.
Einige Anmerkungen zu dem Text des Vater unser. Die Gottheitsbezeichnung „Vater“ ist vielfältig anzufinden. Betrachtet man aber – besonders in den Evangelien – das Wort Vater, tritt dort das patriarchalisch-autoritäre Element sehr in den Hintergrund und das Element des Vertrauens, ja der Liebe dominiert. Besonders wird dies im Gleichnis vom barmherzigen Vater spürbar. Von den Jüngern und Jesus wird überliefert, dass sie das noch zärtlichere „Abba“ verwendet haben, in dem die besondere Beziehung zwischen Gott und den Menschen ausgedrückt wird.
Auffallend ist, dass im gesamten Gebet nicht ein einziges Mal das Wort „ich“ vorkommt, sondern, dass dem „Du“ Gottes das „Wir“ der Menschen gegenübersteht. Damit wird deutlich, dass alle Gebete sich auf das Gelingen der Gemeinschaft zwischen Gott und den Menschen und zwischen den Menschen ausrichten sollen.
Das Vater unser umfasst sieben Bitten. Wie auch im ersten der zehn Gebote wird in der ersten Bitte der Blick auf Gott gelenkt. Ihm wird zugetraut, dass er seine „Interessen“ durchsetzen kann. Unsere Aufgabe ist es, von Gott groß zu denken und auf seine Weisheit und seine Wege zu achten.
In der zweiten Bitte erkennen wir, dass die Welt – so wie sie ist – nicht in Ordnung ist und wir eine Ahnung davon haben, dass die Gegenwart Gottes eine neue – seine – Ordnung herstellt.
Gott hat also eine Zukunft mit dieser Welt. In Jesus Christus ist er zu den Menschen gekommen, um diese in die Nähe Gottes mitzunehmen. So beschreiben es die am Anfang der Bergpredigt stehenden Seligpreisungen.
In der dritten Bitte – so Martin Luther – will Gott uns lehren, „dass wir keinen größeren Feind haben als uns selber. Unser Eigenwille ist der Hauptbösewicht.“
Die Bitte um das tägliche Brot ist die mittlere der sieben Bitten. Vom „Du“ Gottes geschieht nun der Wechsel zum „Wir“ der Betenden. An der Spitze der „Wir“ Bitten steht die Erkenntnis, dass der Mensch ein “Hungerwesen“ ist. Aber es geht nicht nur um die persönliche Nahrung, sondern das „Brot“ hat seinen Bezug zur Gemeinschaft mit anderen.
(Dies wird besonders in der Erklärung Luthers zu dieser Bitte deutlich.) Unter den vielen Bildern des Neuen Testamentes, die das Wort Gottes umschreiben, ist auch das des Brotes.
Gottes Wort ist also Lebens- und Gemeinschaftsmittel, was besonders im Abendmahl sichtbar wird.
Die fünfte Bitte zeigt auf, dass da, wo der Kampf um das tägliche Brot geschieht, Schuld entsteht. Nach biblischem Verständnis ergibt sich die Schuld als Folge der Sünde. Sünde ist immer ein Ausdruck für das Nichtgelingen des Verhältnisses des Menschen zu Gott. In der These 1 seiner Ablassthesen sagt Luther, dass Gott will, „dass das ganze Leben seiner Gläubigen auf Erden eine stete Buße sein soll.“ Der Anerkennung als Gottes Schuldner folgt die Gnade Gottes für den Menschen, aus der wiederum heraus die Fähigkeit des dreifachen Gebens folgt: Geben des Brotes, Vergeben und Weitergeben. Diese Bitte wird damit zum Prüfstein menschlicher Beziehungen.
Der labile Mensch; deswegen die Bitte „Und führe uns nicht in Versuchung“.
Das oder der Böse; beides ist denkbar, wenn wir bitten: Erlöse uns von dem Bösen.
Versuchungen gehören zu den normalen Erfahrungen jedes Menschen. Mit dieser Bitte gestehen wir ein, dass diese da sind. Wir bitten – und damit schließt sich der Kreis der Bitten und führt zu dem Anfang des Gebetes zurück, dass „Unser Vater im Himmel“ der Helfer ist, der uns durch unsere Schwäche hindurch führt.
Die letzten Worte des Vater unser haben ursprünglich nicht zu dem Gebet gehört. Erst im 2. Jahrhundert ist das Lob Gottes dem Text des Gebetes angefügt worden.
Amen heißt: das ist wahr und gewiss!
Predigttext zum Sonntag Kantate am 6. Mai aus dem Buch des Propheten Jesaja, Kapitel 12, die Verse 1 – 6
Zu der Zeit wirst du sagen:
Ich danke dir, Herr, dass du zornig gewesen bist über mich
und dein Zorn dich gewendet hat und du mich tröstest.
Siehe, Gott ist mein Heil, ich bin sicher und fürchte mich nicht;
denn Gott der Herr ist meine Stärke und mein Psalm und ist mein Heil.
Ihr werdet mit Freuden Wasser schöpfen aus den Heilsbrunnen.
Und ihr werdet sagen zu der Zeit:
Danket dem Herrn, rufet an seinen Namen!
Machet kund unter den Völkern sein Tun,
verkündiget, wie sein Name so hoch ist!
Lobsinget dem Herrn, denn er hat sich herrlich bewiesen.
Solches sei kund in allen Landen!
Jauchze und rühme, du Tochter Zion.
denn der Heilige Israels ist groß bei dir!
Kantate = Singet dem Herrn ein neues Lied; der vierte Sonntag nach Ostern ist der Sonntag der Kirchenmusik.
Der Predigttext, die alttestamentliche Lesung dieses Sonntages aus dem Buch des Propheten Jesaja, Kapitel 12, die Verse 1 – 6 wird in der Lutherbibel überschrieben mit „Das Danklied der Erlösten“.
Das umfangreichste prophetische Buch des Alten Testamentes gibt mit dem Namen des Propheten Jesaja (deutsch: Jahwe rettet) auch den inhaltlichen Schwerpunkt an, der die 66 Kapiteln aus unterschiedlichen Epochen der jüdischen Theologie- und Frömmigkeitsgeschichte zusammenfasst, deren Endredaktion in die nachexilische Zeit (5. vorchristliches Jahrhundert) fällt.
Die Berufung Jesajas zum Propheten fällt in das Jahr 736 vor Christus (Jesaja 6, 1ff.). Der letzte jüdische König Hiskia, unter dem Jesaja wirkte, stirbt 697. In Kapitel 1, 4 – 9 beklagt er die ganze Trostlosigkeit, in der sich Jerusalem und das dazu gehörende Gebiet nach den politischen Verirrungen des jüdischen Königshauses befinden.
Jesaja, der nach Kapitel 7, 1ff. direkten Zugang zum jüdischen Königshaus hat, ist der erste Unheilsprophet im Bereich des Südreiches. Zeitgleich treten im Nordreich die Propheten Amos und Hosea auf. Der Prophet Jesaja, durch eine Berufungsvision (6, 1ff) in sein Amt berufen, lehnt die Kriegs- und Bündnispolitik der in seiner Zeit regierenden jüdischen Könige ab. Seine Kritik geht mit der Ankündigung von Unheil einher, denn Jahwe wird für die politischen Vergehen ein großes Strafgericht senden. In die Wirkungszeit des Jesaja fallen eine Reihe politischer Katastrophen für das Nord- wie das Südreich. Im Zweistromland steigt das neuassyrische Reich zu einer Weltmacht auf und bedroht die syrophönizischen Kleinstaaten, zu denen Nord- und Südreich gehören. 722 vor Christus geht das Nordreich unter; Aufstandsversuche und Kriegskoalitionen gegen die Weltmacht führen zu weiteren Niederlagen, die Jesaja kritisch beurteilt. Mit seiner elementaren und visionären Sprache ruft er zur Wiederbelebung der Davidszeit und der ersten Jerusalemer Zeit auf. „Alsdann wirst du eine Stadt der Gerechtigkeit und eine treue Stadt heißen. Zion muss durch Gericht erlöst werden und, die zu ihr zurückkehren, durch Gerechtigkeit.“ (1,26b.27)
Der Predigttext ist ein den Psalmen nachempfundenes Danklied, das in der nachexilischen Zeit (5. vorchristliches Jahrhundert) von den jüdischen Theologen, die das gesamte Jesajabuch mit seinen 66 Kapiteln zu einem inhaltlichen Gesamtwerk zusammengefügt haben, eingefügt worden ist. An dem Jesajabuch kann man also sehr schön den fortschreitenden Prozess der theologischen Aktualisierung verfolgen, denn dieser Prozess umfasst einen Zeitraum von ca. 200 Jahren. Die Aktualität des Jesajabuches erschließt sich besonders aus den Kapiteln 40 – 55, dem so genannten Deuterojesaja. Schon im Prolog des Kapitels 40 wird das von Gott her geschehene Heil als vollzogen ausgerufen. „Redet mit Jerusalem freundlich und predigt ihr, dass ihre Knechtschaft ein Ende hat.“ (40, 2) Es ist eine Freudenbotschaft, die da verkündet wird. Diese Freude gilt jedem Einzelnen. Diese Gedanken nimmt auch unser Predigttext auf. Das dreimal gebrauchte Wort „Heil“ erinnert an die Bedeutung des Namens Jesaja = Jahwe hat geholfen; rettet. Im ganzen Buch erscheint es 18mal. Damit wird deutlich, dass die großen Themen „Gottes Zorn und Hilfe; Furcht und Vertrauen“ aktuell formuliert werden.
Gottes Zorn ist Ausdruck seiner Liebe – ein merkwürdiger klingender Gedanke. Es nicht der Zorn, der oft die zwischenmenschlichen Beziehungen prägt, sondern sein Nein, sein „Zorn“ gegen die Sünde. Da aber die Sünde Gottes Liebe abweist, ist sein Zorn gegen die Sünde ein Liebesbeweis für den Menschen. Der Mensch der dies erkennt, kann Gott auch für seinen Zorn danken.
So entstehen neue Kraft und Stärke. Es ist wie eine Quelle, aus der Einzelne wie auch die Völker schöpfen können.
So ist dieser Text ein Lied für die Gegenwart. Die Gotteserfahrungen der vorherigen Generationen werden aufgenommen und im Singen angeeignet. Das Singen in unseren Gottesdiensten schafft eine Verbindung zwischen der Gemeinde und dem Einzelnen in seiner religiösen Existenz. So ist das Singen wie ein Schöpfen aus den Quellen des Heils.
Predigttext zum Sonntag Jubilate (29. April) aus dem 1. Buch Mose, Kapitel 1, die Verse 1 – 4a, 26 – 31 und Kapitel 2, die Verse 1 – 4a
Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und die Erde war wüst und leer, und es war finster auf der Tiefe; und der Geist Gottes schwebte auf dem Wasser.
Und Gott sprach: Es werde Licht! Und es ward Licht. Und Gott sah, dass das Licht gut war.
Und Gott sprach: Lasset uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei, die da herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über das Vieh und über alle Tiere des Feldes und über alles Gewürm, das auf Erden kriecht. Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn; und schuf sie als Mann und Frau. Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen: Seid fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde und machet sie euch untertan und herrschet über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über das Vieh und alles Getier, das auf Erden kriecht. Und Gott sprach: Sehet da, ich habe euch gegeben alle Pflanzen, die Samen bringen, auf der ganzen Erde, und alle Bäume mit Früchten, die Samen bringen, zu eurer Speise. Aber allen Tieren auf Erden und allen Vögeln unter dem Himmel und allem Gewürm, das auf Erden lebt, habe ich alles grüne Kraut zur Nahrung gegeben. Und es geschah so. Und Gott sah an alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Da ward aus Abend und Morgen der sechste Tag.
So wurden vollendet Himmel und Erde mit ihrem ganzen Heer. Und so vollendete Gott am siebenten Tage seine Werke, die er machte, und ruhte am siebenten Tage von allen seinen Werken, die er gemacht hatte. Und Gott segnete den siebenten Tag und heiligte ihn, weil er an ihm ruhte von allen seinen Werken, die Gott geschaffen und gemacht hatte. So sind Himmel und Erde geworden, als sie geschaffen wurden.
„Jauchzet Gott alle Lande“ = Jubilate, so lautet der Name des dritten Sonntages nach Ostern.
Der Predigttext ist die in unserem Gesangbuch unter der Nummer 954.36 abgedruckte Lesung aus dem Alten Testament.
Dieser Text stellt eine besondere Herausforderung dar, denn er könnte uns dazu verführen, über den Zusammenhang von Schöpfung und Evolution nachzudenken.
Unser Text ist nach den Erkenntnissen der biblischen Wissenschaft in der zweiten Hälfte des ersten Jahrtausends (vor Christus) verfasst. Naturwissenschaftlich bewegt er sich auf den Erkenntnissen der einfachen Beobachtung der Phänomene. Es ist nicht seine Absicht, wissenschaftliche Meinungen und Theorien auszudrücken.
Wir haben es also mit einem Zeugnis Gottes für die Menschheit und für Israel zu tun.
Der vorgesehene Predigttext stellt eine Auswahl von Versen des ersten der beiden Schöpfungsberichte dar, mit denen unsere Bibel beginnt. Der Abschnitt 1, 1 – 2, 4a wird als „erster“ Bericht angesehen, dem ab Kapitel 2, 4bff. ein „zweiter“ folgt. Die Tatsache, dass das Schöpfungsthema in so ausführlicher Form am Anfang der Bibel steht, geschieht ausschließlich aus chronologischen Gründen. Erst gegen Ende des babylonischen Exils (5. Jahrhundert) beginnt die jüdische Theologie über die Schöpfung des Weltalls bekenntnismäßig nachzudenken. In der Zeit des babylonischen Exils begegnete die dorthin verbrachte Elite des Volkes als ethnische und religiöse Minderheit einer kulturellen Übermacht. In der theologischen Auseinandersetzung mit dem ihnen fremden „Religionsgut“ entwickelten sie die Aussagen, die wir besonders in dem ersten Schöpfungsbericht finden.
Literarisch werden die Texte der Urgeschichte (1. Mose 1 – 11) als Mythen bezeichnet. In der Forschung der letzten hundert Jahre ist gelungen, eine Reihe von vergleichbaren Texten aus den verschiedenen Religionen des Alten Orients zu finden, die sich mit dem Ursprung des Weltalls und der Menschheit beschäftigen.
Interessant wird der Vergleich der biblischen Texte mit den Texten der verschiedenen Religionen des Alten Orients, wenn man die Unterschiede beachtet.
So ist zum Beispiel das Bekenntnis, dass Gott das Weltall geschaffen hat, eine polemische Antwort auf den in den anderen Religionen vorkommenden Polytheismus.
So wird man davon ausgehen müssen, dass der erste Schöpfungsbericht neben der chronologischen Absicht, dass „von Anfang an“ die Geschichte Gottes mit seinem Volk geschieht, der Sabbat als Krönung der Schöpfung legitimiert werden soll, denn die acht Werke der Schöpfung werden auf sechs Tage verteilt. Nach deren Ende hört Gott auf, um am siebenten Tag auszuruhen. Dieser Tag wird gesegnet und geheiligt; das heißt: er wird von den anderen Tagen abgesondert.
Es gibt keine Parallelen für den Sabbat im altorientalischen Raum. Damit ist er nach der Absicht und dem Verständnis des Alten Testamentes göttlichen Ursprunges. Das zeigt sich auch darin, dass die Sabbatruhe religiöse wie soziale Funktionen hat. Alle – Menschen und Tiere, Freie und Sklaven, Israeliten und Fremde – sind zur Ruhe verpflichtet. (Nur in Angelegenheiten, in denen es um Leben und Tode geht, darf die Sabbatruhe verletzt werden.)
Diese in der Sabbatruhe sichtbare Krönung der Schöpfung zeigt sich auch in der Vollkommenheit, in der die ganze Schöpfung der göttlichen Souveränität entsprechend bis hin zu der Ebenbildlichkeit des Menschen geschieht.
Predigttext zum Sonntag Miserikordias Domini (22. April) steht im Evangelium des Johannes, Kapitel 21, die Verse 15- 19
Als sie nun das Mahl gehalten hatten, spricht Jesus zu Simon Petrus:
Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieber, als mich diese haben? Er spricht zu ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm: Weide meine Lämmer!
Spricht er zum zweiten Mahl zu ihm: Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Er spricht zu ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm: Weide meine Schafe!
Spricht er zum dritten Mal zu ihm: Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, weil er zum dritten Male zu ihm sagte: Hast du mich lieb? und sprach zu ihm: Herr, du weißt alle Dinge, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm: Weide meine Schafe!
Wahrlich, wahrlich, ich sage dir: Als du jünger warst, gürtetest du dich selbst und gingst, wo du hinwolltest; wenn du aber alt wirst, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich gürten und führen, wo du nicht hinwillst. Das sagte er aber, um anzuzeigen, mit welchem Tod er Gott preisen würde. Und als er das gesagt hatte, spricht er zu ihm: Folge mir nach!
Der zweite Sonntag nach Ostern trägt den Namen Miserikordias Domini = Der Güte des Herrn ist voll die Erde. Prägnanter ist die Bezeichnung Hirtensonntag, an dem als zweite Lesung das Evangelium vom guten Hirten aus dem Johannesevangelium gelesen wird.
Einen eigenen Akzent erfährt das Thema vom „Guten Hirten“ durch den in der fünften Predigtreihe vorgesehenen Predigttext aus dem letzten Kapitel des Johannesevangeliums.
Bei der Lektüre des Evangeliums fällt auf, dass mit den Versen 30 und 31 des Kapitels 20 ein Abschluss für dieses formuliert ist. Das 21. Kapitel ist ein Zusatzkapitel, das einen Kommentar zur Bedeutung des Petrus und des Lieblingsjünger Johannes und ihrer Beziehung zueinander darstellt. Unter allen Überlegungen zu der Frage, warum dieses Kapitel dem Evangelium angefügt wurde, scheint mir die nachfolgende am Sinnvollsten zu sein. Beide werden bei der Beachtung des Textes des gesamten Kapitels als Partner dargestellt. Keiner kann dem anderen den Vorrang streitig machen. Petrus ist für den pastoralen und missionarischen Weg der Kirche verantwortlich, während der Lieblingsjünger Johannes der Garant der Jesusüberlieferung ist. Der oder die Endredaktoren des Evangeliums wollten diesen positiven Punkt herausstellen.
Die den Versen 15ff. vorausgehenden Verse 1 – 14 führen in das Thema ein. Die drei Anfragen Jesu, die Antworten des Petrus und die drei Befehle Jesu entsprechen den drei Verleugnungen während des Prozesses vor dem Hohen Rat.
Die erste Frage Jesu weckt die Erinnerung und das Gewissen des Simon, wie er nach Johannes 1, 42 bei seiner Berufung hieß. Beim letzten Abendmahl (Johannes 13, 37) wollte er sich in seiner Liebe zu Jesus von niemanden übertreffen lassen. Im Hof des hohenpriesterlichen Palastes fürchtete er den eigenen Tod und verleugnete seinen Herrn. Dieser Verrat wird nun bereinigt und damit auch deutlich gemacht, was es mit dem „Amt der Schlüssel“, der den Jüngern gegebenen Vollmacht zur Vergebung der Sünden auf sich hat.
Der Hirtenauftrag Jesu bedeutet die Fürsorgepflicht des Petrus für die ihm anvertrauten Menschen. Es geht also nicht um einen Rangstreit zwischen dem Lieblingsjünger Johannes und Petrus oder die Ablösung des einen durch den anderen, sondern darum, dass Petrus in der Nachfolge Jesu zum „Hüter“ seines Bruders wird und als guter Hirte auch für seine Schafe zu sterben bereit ist.
Die abschließenden Verse des Predigttextes weisen auf den Märtyrertod des Petrus hin. Die ausgestreckten Hände und das von einem anderen gefesselt sein weisen auf das Tragen des Querbalken des Kreuzes sein, den der Verurteilte zum Richtplatz tragen musste.
Der Predigttext zum Sonntag Quasimodogeniti (15. April) steht im Evangelium des Markus, Kapitel 16, die Verse 9 – 20
Als aber Jesus auferstanden war früh am ersten Tag der Woche, erschien er zuerst Maria von Magdala, von der sieben böse Geister ausgetrieben hatte. Und sie ging hin und verkündete es denen, die mit ihm gewesen waren und Leid trugen und weinten. Und als diese hörten, dass er lebe und sei ihr erschienen, glaubten sie es nicht. Danach offenbarte er sich in anderer Gestalt zweien von ihnen unterwegs, als sie über land gingen. Und die gingen auch hin und verkündeten es den andern. Aber auch denen glaubten sie nicht.
Zuletzt, als die Elf zu Tisch saßen, offenbarte er sich ihnen und schalt ihren Unglauben und ihres Herzens Härte, dass sie nicht geglaubt hatten denen, die ihn gesehen hatten als Auferstandenen.
Und er sprach zu ihnen: Gehet hin in alle Welt und predigt das Evangelium aller Kreatur.
Wer da glaubt und getauft wird, der wird selig werden; wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden.
Die Zeichen aber, die folgen werden denen, die da glauben, sind diese: In meinem Namen werden sie böse Geister austreiben, in neuen Zungen reden, Schlangen werden sie mit Händen hochheben, und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird´s ihnen nicht schaden; auf Kranke werden sie die Hände legen, so wird´s besser mit ihnen werden.
Nachdem der Herr Jesus mit ihnen geredet hatte, wurde er aufgehoben gen Himmel und setzte sich zur Rechten Gottes. Sie aber zogen aus und predigten an allen Orten. Und der Herr wirkte mit ihnen und bekräftigte das Wort durch mitfolgende Zeichen.
Der erste Sonntag nach dem Osterfest trägt auch die Bezeichnung „Weißer Sonntag“. Mit der deutschen Übersetzung „Wie die neugeborenen Kinder“ des lateinischen Namens „Quasimodogeniti“ erinnert er an die schon in der ersten Zeit der christlichen Kirchen geübte Praxis, dass die zu Ostern getauften Christen ihre weißen Taufkleider bis zu diesem Sonntag trugen. In den letzten zwei Jahrhunderten wurde es Sitte, dass am Weißen Sonntag in den katholischen Gemeinden die Erstkommunion der Kinder begangen wurde, dem mit der Konfirmation am Palmsonntag eine ähnliche Nähe zum Osterfest als dem ursprünglichen Tauftag der Kirche blieb.
Die dem Osterfest folgenden Sonntage haben als liturgische Farbe wie das Oster- und Weihnachtsfest die Farbe Weiß. Nach dem im Mittelalter entstandenen Farbenkanon wird jeweils mit einer der fünf verwendeten Farben Weiß, Rot, Grün, Violett und Schwarz auf den besonderen theologischen Schwerpunkt der Sonntage bzw. Kirchenjahreszeit hingewiesen. Diese Farben und ihre Bedeutung zeigen sich in den gottesdienstlichen Gewändern (katholisch) und den an Kanzel und Altar verwendeten Textilien.
Das österliche Weiß weist auf die besondere Bedeutung Jesu als den Auferstandenen und Herrn der Kirche hin.
Am Ende des Predigttextes aus dem Markusevangelium findet sich in meiner Lutherbibel ein Stern, dem dann folgende Erklärung beigegeben ist: Nach den ältesten Textzeugen endet das Markus-Evangelium mit Vers 8. Die Verse 9 – 20 sind im 2. Jahrhundert hinzugefügt worden, vermutlich um dem Markus-Evangelium einen den andern Evangelien entsprechenden Abschluss zu geben.
Dem ist nichts hinzuzufügen.
Dieser Text ist trotz seiner Entstehung zu Beginn des zweiten Jahrhunderts bei der Zusammenstellung der Schriften des Neuen Testamentes als gleichwertig mit den anderen Texten anerkannt worden.
Die in diesem Text wiedergegebene Überlieferung findet sich im Johannes- und Matthäusevangelium, sowie in der Apostelgeschichte.
Auffallend ist in dem Text Markus 16. 9 – 20, wie sehr der Unglaube des Jüngerkreises betont wird. Das Motiv des Unverständnisses der Jünger taucht im Evangelium selbst immer wieder auf. (z.B. 4, 41: Wer ist der? Auch Wind und Meer sind ihm gehorsam!) Gemeint ist damit auch, dass die Jünger nichts von dem „erfunden“ haben, was als zentrale Aussagen des Evangeliums genannt werden: „Das ist mein lieber Sohn; den sollt ihr hören! (9,27) und „Wahrlich, dieser Mensch ist Gottes Sohn gewesen!“ (15,38)
Zu Beginn des zweiten Jahrhunderts bekennt die christliche Gemeinde den „Herrn“ Jesus, sitzend zur Rechten Gottes (Vers 19). Nach Kapitel 1, 14 predigt Jesus das Evangelium Gottes „Die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist herbeigekommen.“ Die Teilhabe an der lebendigen Gegenwart Gottes ist Maria Magdalena mit der Austreibung der sieben Geister widerfahren. Die (damals) gegenwärtige Zeit ist geprägt von Leid und weinen (11); von Unglauben auch unter den Anhängern Jesu (Vers 14). Diesen wird – wenn sie nicht glauben – das Urteil gesprochen „wer nicht glaubt, der wird verdammt werden“.
Die Verkündigung des Evangeliums an jeden Einzelnen (Vers 15) und der Aufruf zur Entscheidung wird der Auftrag an die Gemeinde Jesu Christi. In der Evangeliumspredigt des Markusevangeliums hat sie die Grundlage, um diese Aufgabe durchzuführen.
Die Prediger des Evangeliums werden begleitende Beglaubigungs- und Beistandszeichen in
Aussicht gestellt. An erster Stelle werden erfolgreiche Exorzismen, danach die Fähigkeit zu verständlicher geistlicher Rede genannt. Die Abwehr giftiger Schlangen und Getränke wird ebenso als Zeichen der lebendigen Macht Gottes verstanden, wie die Heilung von Krankheiten durch Handauflegen.
In der Taufe vollzieht sich also ein „Machtwechsel“. Der von bösen Geistern bestimmte Mensch wird durch die lebendige Macht des Auferstandenen zu seinem neuen und wahren Leben geführt. Der im Glauben getaufte Christ nimmt teil an der Gegenwart des Reiches Gottes.
Predigttext zum Sonntag Judika (25. März) aus dem Evangelium des Johannes Kapitel 11,
die Verse 47- 53
Da versammelten die Hohenpriester und die Pharisäer den Hohen Rat und sprachen:
Was tun wir? Dieser Mensch tut viele Zeichen. Lassen wir ihn so, dann werden sie alle an ihn glauben, und dann kommen die Römer und nehmen uns Land und Leute.
Einer aber von ihnen, Kaiphas, der in dem Jahr Hoherpriester war, sprach zu ihnen:
Ihr wisst nichts; ihr bedenkt auch nicht: Es ist besser für euch, ein Mensch sterbe für das Volk, als dass das ganze Volk verderbe.
Das sagte er aber nicht von sich aus, sondern weil er in dem Jahr Hoherpriester war, weissagte er.
Denn Jesus sollte sterben für das Volk und nicht nur für das Volk allein,
sondern auch um die verstreuten Kinder Gottes zusammenzubringen.
Von dem Tage an war es für sie beschlossen, dass sie ihn töteten.
Mit dem Sonntag Judika (Richte mich) beginnt der entscheidende Teil der Fasten- oder Passionszeit. In der Gottesdienstliturgie verstummt nicht nur das Halleluja nach der ersten Lesung und das Ehre sei Gott in der Höhe (Gloria in excelsis), sondern auch das Ehr sei dem Vater (Gloria patri). Aus dem 11. Jahrhundert kommt der Brauch, mit Hunger- oder Fastentüchern den Altar zu verhängen. Damit wurde allen sichtbar vor Augen geführt, dass die „Sündhaftigkeit“ menschlichen Lebens zur Abwesenheit Gottes führt.
Der Predigttext aus dem elften Kapitel des Johannesevangeliums ist mit der Erzählung von der Auferweckung des Lazarus inhaltlich verbunden. Zu beachten sind auch die weiteren Texte der biblischen Lesungen für diesen Sonntag. Der alttestamentliche Text, sowie die Epistel- und die Evangelienlesung umkreisen die Frage: „Wie erlangen wir Zugang zum Reich Gottes bzw. dem ewigen Leben?“
In den Versen 47 – 53 finden wir einen deutlichen Hinweis auf die Abfassungszeit des Evangeliums. Mit der dem „Hohen Rat“ in den Mund gelegten Aussage „dann kommen die Römer und nehmen uns Land und Leute“ wird die im Jahre 70 nach Christus erfolgte Zerstörung des Tempels durch die Römer angesprochen.
Der „Hohe Rat“ oder das „Synedrium“ ist eine seit der Makkabäerzeit (2. vorchristliches Jahrhundert) bestehende Institution der jüdischen Selbstverwaltung. Der Begriff Synedrium ist mehrdeutig und kann „Ältestenrat“ wie auch „Gericht“ bedeuten. Mitglieder dieses 70 bzw. 72 umfassenden Gremiums waren sowohl Vertreter der jüdischen Priesterfamilien als auch Schriftgelehrte; letztere zählten mehrheitlich zu der konservativ geprägten Gruppe der Pharisäer. Ein Vertreter der jüdischen Priesterfamilien führte als „Hoherpriester“ den Vorsitz. Der „Hohe Priester“ als Oberhaupt der Jerusalemer Priesterschaft repräsentierte das jüdische Volk, wurde aber in der römischen Besatzungszeit bis zum Jahre 70 nach Christus von den jeweiligen Herrschern nach Belieben ein- oder abgesetzt. Seine wichtigste religiöse Funktion bestand in der Entsühnung des Volkes am großen Versöhnungstag.
Der in unserem Predigttext genannte Kaiphas wurde um das Jahr 18 nach Christus durch den römischen Statthalter Gratus ernannt und im Jahr 36 nach Christus durch den römischen Prokonsul für Syrien aus dem Amt entfernt. Kaiphas hat sein Amt also fast zwanzig Jahre – also auch in dem Jahr des Leidens Jesu – sein Amt ausgeübt, was seiner „Weissagung“ ein besonderes Gewicht verleiht.
Im Vordergrund unseres Textes scheint der Bericht über die Beratung und den Beschluss des Rates zu gehen. Auf der dahinter liegenden Ebene aber wird die wahre Bedeutung des Sterbens und der Auferstehung Jesu für die Christen angesprochen, damit sie zu der gleichen Erkenntnis wie der Lazarus kommen: Herr, ich glaube, dass du der Christus bist.
Damit rückte der Vers 52 in das Zentrum „Jesus sollte sterben, um die versammelten Kinder Gottes zusammenzubringen.“ Der Kreuzestod Jesu bewirkt Sühne. Diese Deutung spricht – ironischerweise – der Vertreter des jüdischen Volkes aus, der jährlich einmal stellvertretend für das Volk in den allerheiligsten Bereich des Tempels tritt, um Gott mit diesem zu versöhnen. Der Hohepriester Kaiphas „weissagt“ auf den hin, der diese Aufgabe tatsächlich übernimmt. Der Kreuzestod Jesu, der für Kaiphas und das jüdische Volk ein Akt politischer Klugheit sein soll, ist nach dem Willen Gottes das „Zeichen“, das den Menschen wie Lazarus zum Glauben führen soll. Das Evangelium ist geprägt von den „Zeichen, die dieser Mensch tut“. Im Zusammenhang mit dem Weinwunder in Kana (Abendmahl) heißt es: „Das ist das erste Zeichen … und er offenbarte seine Herrlichkeit. Und seine Jünger glaubten an ihn.“
Die Sühnewirkung des Kreuzestodes Jesu soll die Folgen der Gottesferne aufheben. Zu dieser Gottesferne gehören Zerstreuung und Zerrissenheit; die Angst vor den Bedrohungen des Lebens.
Diese Lebensangst bestimmt das Reden und Handeln der Mitglieder des Hohen Rates.
Predigttext für den Sonntag Laetare (18. März) aus dem Evangelium des Johannes, Kapitel 6, die Verse 47 – 51
Wahrlich, wahrlich, ich sage euch:
Wer glaubt, der hat das ewige Leben.
Ich bin das Brot des Lebens.
Eure Väter haben in der Wüste das Mann gegessen und sind gestorben.
Dies ist das Brot, das vom Himmel kommt, damit, wer davon isst, nicht sterbe.
Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel gekommen ist.
Wer von diesem Brot isst, der wird leben in Ewigkeit.
Und dieses Brot ist mein Fleisch, das ich geben werde für das Leben der Welt.
Der Sonntag Laetare ist der vierte Sonntag in der Reihe der Passions- oder Fastensonntage.
Sein lateinischer Name, der Anfang des Kehrverses des Eröffnungsgesanges des Sonntagspsalmes, heißt übersetzt: Freue dich. Mit diesem Motto gibt er diesem Sonntag einen frohen Ton. Manche römischen Traditionen lassen die Vermutung zu, dass dieser Sonntag mit einem Frühlingsfest verbunden war. Eines der beiden für die mit dem Sonntag beginnende Woche vorgesehenen Gesangbuchlieder ist „Jesu meine Freude“. Damit wird deutlich, dass das besondere Geheimnis der Kirchenjahresgestaltung in der Verbindung von natürlichem Jahresablauf und geistlicher Durchdringung desselben besteht.
Der Predigttext dieses Sonntages gehört in den Zusammenhang der Verse 22 – 59 des sechsten Kapitels des Johannesevangeliums. Eingeleitet wird dieses Kapitel mit der Speisung der Fünftausend und der Fahrt der Jünger über den See Genezareth. Die Rede, die in den Versen 22 – 59 folgt, hat ihre Entsprechung in der alttestamentlichen Erzählung von der Weitergabe der zehn Gebote an das Volk Israel. Dies geschieht in der Wüste und nicht in einer Stadt oder einem religiösen Gebäude. Damit wird deutlich, dass die Gebote nicht eine Erfindung des Menschen, sondern Gottes Wort ist, das dort empfangen wird.
In dem Text des Johannes finden wir eine ähnliche Bewegung Jesu hin zu einem Ort, der von den Menschen erst aufgesucht und gefunden werden muss. Jesu Rede über das Brot des Lebens zeigt seine Autorität, die größer ist als die des Mose.
Auffallend in dem Evangelium des Johannes ist der mehrfache Gebrauch des Satzanfanges „Ich bin“. Im alten Testament sind sie die Einleitung zu göttlichen Worten und Geboten.
„Ich bin“ Sätze sind also Sätze der göttlichen Selbstoffenbarung. Im johanneischen Text bedeutet das, dass er – Jesus – das Brot des Lebens ist, welches Leben gibt. Er ist das Mittel, durch welche Menschen das ewige Leben gewinnen. Dieses Mittel ist eine Person und kann deswegen nur personal und nicht mechanisch angeeignet werden.
Deutlich wird in unserem Predigttext, dass die Vorstellung vom himmlischen Brot ihren Ursprung im Alten Testament und im jüdischen Denken hat. Sie geht aus von der Gabe des Manna. (Im zweiten Buch Mose, Kapitel 16, 13ff. findet sich die Erzählung von der Speisung des Volkes Israel während der Wüstenwanderzeit. Manna ist ein Saft der Tamariskensträucher, der durch Umwandlung wie Tau oder Regentropfen an diesen haftet. Die herab fallenden Kügelchen bedecken den Wüstenboden und sind in der Kühle des Morgens als wie Honig schmeckend essbar, bevor sie durch die Wärme der Sonne verflüssigt werden.)
Manna fällt „vom Himmel“ wie der Tau. In der Weisheitsliteratur Israels wird dann das Manna als „Wort“ und „Lehre“ interpretiert. Gott speist die Menschen durch sein Wort.
Aber die Menschen des Alten Testamentes – die Väter – wussten nichts von einem Leben, das dem Tod überlegen ist. Gott aber hat die Macht, mit der er Leben spendet und die Toten erweckt, auf Jesus übertragen. Deshalb ist Jesus lebendig machendes Brot.
Mit dem zweimaligen „Wahrlich, wahrlich“ des ersten Verses des Predigttextes wird deutlich, dass Jesus Christus der inhaltliche Schwerpunkt dieses Textes ist. Wer oder was Christus für uns ist, wird zur Aufgabe und zum Thema einer Predigt werden müssen.
Predigttext zum Sonntag Okuli (11. März) aus dem Buch des Propheten Jeremia, Kapitel 20, die Verse 7 – 13
Herr, du hast mich überredet und ich habe mich überreden lassen.
Du bist mir zu stark gewesen und hast gewonnen;
Aber ich bin darüber zum Spott geworden täglich, und jedermann verlacht mich.
Denn sooft ich rede, muss ich schreien; „Frevel und Gewalt!“ muss ich rufen.
Denn des Herrn Wort ist mir zu Hohn und Spott geworden täglich.
Da dachte ich: Ich will nicht mehr an ihn denken und nicht mehr in seinem Namen predigen.
Aber es wird in meinem Herzen wie ein brennendes Feuer, in meinen Gebeinen verschlossen, dass ich´s nicht ertragen konnte; ich wäre schier vergangen.
Denn ich höre, wie viele heimlich reden:
„Schrecken ist um und um!“ „Verklagt ihn!“„Wir wollen ihn verklagen!“
Alle meine Freunde und Gesellen lauern, ob ich nicht falle:
„Vielleicht lässt er sich überlisten, dass wir ihm beikommen können und uns an ihm rächen.“
Aber der Herr ist bei mir wie ein starker Held, darum werden meine Verfolger fallen und nicht gewinnen. Sie müssen ganz zuschanden werden, weil es ihnen nicht gelingt.
Ewig wird ihre Schande sein und nie vergessen werden.
Und nun, Herr Zebaoth, der du die Gerechten prüfst, Nieren und Herz durchschaust:
Lass mich deine Vergeltung an ihnen sehen; denn ich habe dir meine Sache befohlen.
Singet dem Herrn, rühmet den Herrn, der des Armen Leben aus den Händen der Boshaften errettet!
Der dritte Sonntag in der Passionszeit mit dem lateinischen Namen Okuli (Meine Augen)
stand in der frühen Christenheit in deutlicher Beziehung zur Taufvorbereitung. Am dritten, vierten und fünften der Passionssonntage fanden die „Teufelsaustreibungen“ statt, die ein Teil der Prüfungen der Taufbewerber waren.
Die jetzige evangelische Ordnung der biblischen Lesungen dieses Sonntages stellt den Ruf in die Nachfolge in das Zentrum. Nach der Predigtreihenordnung ist die fünfte Reihe als Predigttexte dieses Kirchenjahres vorgesehen, in der für diesen Sonntag ein alttestamentlicher Text vorgeschrieben ist.
Der Prophet Jeremia (Jahwe erhöht) entstammt wahrscheinlich der Priesterfamilie des Abjatar, die nach dem ersten Königebuch (Kapitel 2, 26) von dem König Salomo nach Anatot (nordöstlich von Jerusalem) verbannt worden ist. Jeremia dürfte um 650 vor Christus geboren und nach Kapitel 1, Vers 2 627/626 zum Propheten berufen worden sein. Sein Wirken und Leben endet nach der 587 vor Christus geschehenen Einnahme Jerusalems und dem Beginn des babylonischen Exils bei einer Gruppe jüdischer Mitbürger, die entgegen dem Rat des Jeremia nach Ägypten ausweichen (s. Kapitel 40 – 43)
So ist das Leben und die Wirksamkeit des Jeremia mit der politischen Geschichte und dem Untergang des so genannten Südreiches, dem judäischen Reich mit seiner Hauptstadt Jerusalem verbunden. Dieser kleine politische Bereich war zu allen Zeiten von den Interessen der Großmächte abhängig. In der Mitte des siebten vorchristlichen Jahrhunderts zerfällt das assyrische Großreich. Dadurch gewinnen die kleinen Staaten des syro-phönizischen Raumes vorübergehend politische Bewegungsfreiheit. Der jüdische König Josia nützt diese Zeit außenpolitisch zu dem Versuch der Wiederherstellung des davidischen Großreiches und innenpolitisch zu einer Kultreform. Im Jahre 621 vor Christus wird im Tempel das deuteronomische Gesetzbuch (2. Könige 23) gefunden und eine Reinigung des Tempels und des jüdischen Kultes von allen nichtjüdischen Elementen durchgeführt. Im Jahr 609 ist das Ende der jüdischen Freiheitshoffnungen mit dem Tod des Königs Josia
besiegelt; seine Nachfolger geraten immer in den Strudel der großmachpolitischen Auseinandersetzungen mit der nun die Assyrer ablösenden babylonischen Großmacht und Ägptens.
Aus dem umfangreichen Prophetenbuch ist zu erkennen, dass uns hier eine Persönlichkeit entgegentritt, deren göttliche Berufung zu einem inneren und äußeren Kampf gegen Menschen und Mächte bestimmt war. Er muss Gottes Wort reden, auch wenn er schweigen wollte.
Die unserem Predigttext vorausgehende Predigt des Jeremia und deren Folgen lassen die ungeheure Dramatik dieses Prophetenlebens spüren. In den Versen 7 – 18 lesen wir das erschütternde Zeugnis einer Selbstzerfleischung und einer Anklage Gottes. Mit anderen Bekenntnissen in dem Jeremiabuch ist hier das stärkste Zeugnis für die menschliche Tragödie der alttestamentlichen Prophetie zu lesen.
Der Abschnitt der Verse 7 – 13 besteht aus drei Teilen. In den Versen 7 -9 sieht Jeremia sich der Übermacht Gottes wehrlos ausgeliefert und spricht in einer Selbstklage von dem Gespött, dem er ausgesetzt ist. Er schreit im Namen Gottes gegen die ungerechten Zustände, aber alle demütigen ihn.
Im Vers 10 beschreibt er in einer Feindklage die heillose Situation des Propheten. Sogar seine nächsten Angehörigen lauern auf seinen Sturz.
Aber gerade in der tiefsten Anfeindung erfährt Jeremia, dass Gott auf seiner Seit steht. Gott wird auch die Gegner des Propheten überwältigen, denn die ihm zugefügte Schande wird auf sie zurückfallen.
Mit einem Hymnus, einem Lied, das die Erfahrung des rettenden Gottes besingt, endet der Text.
Predigttext zum Sonntag Reminiscere (4. März) aus dem Evangelium des Johannes, Kapitel 8,
die Verse 21 – 30
Da sprach Jesus abermals zu ihnen: Ich gehe hinweg und ihr werdet mich suchen und in eurer Sünde sterben. Wo ich hingehe, da könnt ihr nicht hinkommen.
Da sprachen die Juden: Will er sich denn selbst töten, dass er sagt: Wo ich hingehe, da könnt ihr nicht hinkommen?
Und er sprach zu ihnen: Ihr seid von unten her, ich bin von oben her; ihr seid von dieser Welt, ich bin nicht von dieser Welt. Darum habe ich euch gesagt, dass ihr sterben werdet in euren Sünden; denn wenn ihr nicht glaubt, dass ich es bin, werdet ihr sterben in euren Sünden.
Da fragten sie ihn: Wer bist du denn? Und Jesus sprach zu ihnen: Zuerst das, was ich euch auch sage. Ich habe viel von euch zu reden und zu richten. Aber der mich gesandt hat, ist wahrhaftig, und was ich von ihm gehört habe, das rede ich zu der Welt.
Sie verstanden aber nicht, dass er zu ihnen vom Vater sprach.
Da sprach Jesus zu ihnen: Wenn ihr den Menschensohn erhöhen werdet, dann werdet ihr ihn erkennen, dass ich es bin und nichts von mir selber tue, sondern, wie mich der Vater gelehrt hat, so rede ich. Und der mich gesandt hat, ist mit mir. Er lässt mich nicht allein, denn ich tue allezeit, was ihm gefällt.
Der zweite Sonntag in der Passionszeit trägt den lateinischen Namen Reminiscere (Gedenke, Herr).
Der Predigttext, die alttestamentliche und die Evangelienlesung haben antijüdische Tendenzen. Hier ist es notwendig, die historische Situation besonders der neutestamentlichen Texte zu beachten.
Das Johannesevangelium nimmt eine besondere Stellung in der Entwicklung des frühchristlichen Denkens ein. Dabei haben sich alle Versuche als sehr schwierig erweisen, die Fragen nach der Verfasserschaft, der Entstehungszeit und der Zusammensetzung der Texte innerhalb des Evangeliums abschließend zu klären.
Der in Kapitel 20, Vers 31 stehende Satz „Dies ist geschrieben, damit ihr glaubt“ soll nicht auf einen historischen Bericht über Jesu Wirken, sondern auf eine Glaubenslehre, eine „Theologie“ hinweisen, damit Menschen ihre Beziehung zu Gott erkennen. Die wirkliche Geschichte des Jesus von Nazareth ist von überragender Bedeutung. Die historischen Daten sind aber unabhängig von dem Glauben, dass Jesus das fleischgewordene Wort Gottes ist, unbedeutend. Das Johannesevangelium ist also eine „gedeutete“ Geschichte Jesu.
Nimmt man eine Entstehungszeit des Evangeliums zwischen 90 – 140 nach Christus an, dann wird man allgemein sagen können, dass das Evangelium zu dem Zweck geschrieben wurde, in einer kritischen Situation der jungen Kirche die grundlegenden Überzeugungen des christlichen Glaubens zu bestätigen.
Ein Problem war das der christlichen Eschatologie. In den Paulusbriefen wird deutlich, dass die ersten Christen die Wiederkunft Christi noch zu ihren Lebzeiten erwarteten. Nun – nach mehr als fünfzig Jahren des Ausbleibens der Ankunft Christi – musste dies positiv verstanden werden. Im Johannesevangelium findet diese neue Sicht ihren Niederschlag, in dem eine Spannung zwischen Hoffnung und Verwirklichung aufgebaut wird.
Ein anderes Problem war die Auseinandersetzung mit den Mysterienreligionen der damaligen Zeit und hier besonders mit der Gnosis. (Ich gehe im Zusammenhang mit diesem Predigttext nicht auf diese „Philosophie“ ein. Wichtig ist, dass zu dieser Geisteshaltung eine Flucht in die Welt des Mystizismus und der Phantasie gehört. Dem setzt das Evangelium entgegen, dass es den historischen Jesus von Nazareth gab, der in Palästina lebte und starb.)
Ein drittes Problem ist darin zu sehen, dass die jungen christlichen Gemeinden in der theologischen Auseinandersetzung mit „den Juden“ die Trennung zwischen sich und diesen vollzogen. Es ist die Absicht des Evangeliums zu beweisen, dass Jesus der jüdische Messias war. Diese „Auseinandersetzung“ beginnt im Evangelium Kapitel 1, 19ff. mit der Erklärung Johannes des Täufers, er sei nicht der Christus. Dieser Täufer Johannes steht für die Zeit des Judentums, das lediglich „den Weg des Herrn zu ebnen“ hat.
So dürfte das Evangelium auch mit der Absicht geschrieben sein, die Angehörigen des griechisch sprechenden Diasporajudentums für den christlichen Glauben zu gewinnen.
Unser Predigttext steht in dem Zusammenhang des Abschnittes Kapitel 5 Vers bis 8, 59, in dem das Verhältnis Jesu zu besonderen Fragen mit dem Judentum behandelt wird.
In dem Abschnitt 8, 12 – 59 konzentriert sich die Auseinandersetzung auf die Person und die Vollmacht Jesu selbst.
Deutlich ist den Versen 21 – 30 die Ablehnung der Christen durch die jüdische Gemeinde wahrzunehmen. Der Text ist kunstvoll aufgebaut. Er besteht aus vier Teilen. Jeder Teil beginnt mit einer Rede Jesu und hört mit dem Unverständnis der Juden auf. Dieses Unverständnis wird als Kennzeichen ihres Unglaubens dargestellt. In der dualistischen Sprache Jesu gibt es ein „von unten“ und ein „von oben“. Wer „von unten“ ist gehört zur „Welt“, dem gottfernen Bereich. Damit gehört er nicht in den Bereich Gottes und stirbt in seinen Sünden einen Tod ohne Hoffnung.
Es wird nirgendwo in diesem Text sichtbar, dass die Juden eine Chance haben, noch zum Glauben zu kommen; der Ausschluss der Christen aus den jüdischen Gemeinden kommt hier zum Ausdruck.
Die evangelische Botschaft dieses Textes wird darin sichtbar, dass Jesus Christus allein die Grundlage des Glaubens ist. „Wenn ihr nicht glaubt: Ich bin es, dann werdet ihr sterben in euren Sünden (Vers 24).
Ein prädikatsloses „Ich bin“Wort Jesu, in dem er auf seine Einheit mit dem Vater hinweist. So ist es schon im „Prolog“ des Evangeliums zu lesen: „Niemand hat Gott je gesehen; der eingeborene Sohn, der in des Vaters Schoß ist, der hat ihn uns verkündet“ (1, 18).
Jesus ist der einzige Zugang zum Vater. So ist also der Satz zu verstehen, dass er „von oben her“ sei. Am Kreuz geschieht nach dem Johannesevangelium die Erhöhung Jesu. Es ist die Rückkehr zum Vater. Damit ist das Kreuz der Zugang zum Leben.
Predigttext zum Sonntag Invokavit (25. Februar) aus dem Evangelium des Lukas, Kapitel 22, die Verse 31 – 34
Simon, Simon, siehe, der Satan hat begehrt , euch zu sieben wie den Weizen.
Ich aber habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre.
Und wenn du dereinst dich bekehrst, so stärke deine Brüder.
Er aber sprach zu ihm: Herr, ich bin bereit, mit dir ins Gefängnis
und in den Tod zu gehen.
Er aber sprach: Petrus, ich sage dir: Der Hahn wird heute nicht krähen,
ehe du dreimal geleugnet hast, dass du mich kennst.
Mit diesem Sonntag beginnt die Fasten- oder Passionszeit der christlichen Kirchen. Sie dauert vierzig Tage. Eine Reihe von biblischen Texten beschreiben diesen Zeitraum als Zeit des Übergangs, der Buße und der Läuterung. Die seit dem 4. nachchristlichen Jahrhundert bezeugte Fastenzeit ist unabhängig von dem Osterfest als eine inhaltlich eigene Kirchenjahreszeit verstanden worden. Mit dem Beginn dieser Zeit traten die Taufbewerber in einen neuen Abschnitt der Vorbereitung zur Taufe ein, in dem vor allem Prüfungen ihres Lebenswandels und ihres Glaubens standen.
Weiter wurden die 40 Tage als Bußzeit genutzt, die durch das Fasten einen geistlichen Inhalt erhielt. In dieser Zeit wurde nur eine Mahlzeit zu sich genommen und man verzichtete auf Fleisch, Wein, Milch, Butter, Käse und Eier. Dieses Vollfasten sollte als eine Waffe im Kampf gegen Versuchungen und zur Intensivierung des Gebetes dienen. Der soziale Charakter der Fastenzeit war darin zu sehen, dass durch die Verringerung der Nahrungsaufnahme Versorgungskrisen am Ende der Winterzeit besser bewältigt werden konnten.
Eine dritte Bedeutung dieser Zeit ergab sich dadurch, dass diejenigen, die durch Verfehlungen aus den Gemeinden ausgeschlossen worden waren, diese Zeit als eine „Bußzeit“ nutzen konnten, um am Gründonnerstag wieder in die Gemeinde aufgenommen zu werden.
In den evangelischen Kirchen hat sich die Bezeichnung „Passionszeit“ stärker durchgesetzt, so dass diese Zeit als Vorbereitungszeit auf das Osterfest anzusehen ist.
Der Beginn dieser Zeit mit einem Wochentag, dem Aschermittwoch, ist dadurch zu erklären, dass die sechs Sonntage fastenfrei waren. So wurden die 40 Fastentage um den Karfreitag und Karsamstag, sowie die vier Wochentage vor dem Sonntag Invokavit nach vorne geschoben. Der Bußcharakter dieses Wochentages wird in den katholischen Kirchen noch heute darin deutlich, dass durch ein Aschekreuz an der Stirn die Bußbereitschaft betont wird.
Die Namen der sechs kommenden Passionssonntage sind mit einem Merkvers gut zu behalten.
„In (Invokavit) rechter (Reminiscere) Ordnung (Okuli) lerne (Lätare) Jesu (Judika) Passion (Palmarum).
Die lateinischen Worte des Kehrverses zum Eingangspsalm geben diesem und den nächsten Sonntagen den Namen. „Er hat mich gerufen – Invokavit“
Der Predigttext ist ein Abschnitt aus den dem Abendmahl folgenden „Tischgesprächen“.
Alle drei Textabschnitte gehören zu dem „Sondergut“ des Lukasevangeliums, das heißt Texten, die nur in diesem Evangelium zu finden sind. Nach der am Anfang des Kapitels 22 zu lesenden Ankündigung des Verrats nimmt Jesus also noch dreimal das Wort, um danach gegenüber den Jüngern zu schweigen. Der Leser kann durchaus zu dem Eindruck kommen, dass der dem Kreuzestod Geweihte sein testamentarisches Vermächtnis weitergibt.
Jesus redet Petrus mit seinem ursprünglichen jüdischen Namen Simon stellvertretend für alle Jünger an. Dadurch hebt er seine besondere Stellung und Verantwortung hervor. Alle Jünger haben nach Vers 31 noch eine Zeit der Erprobung vor sich. In allen Evangelien werden die „satanischen“ Erprobungen so verstanden, dass der Erprobte zeigen soll, wie weit er seinen Willen an Gottes Willen gebunden hat. Bereits in wenigen Stunden wird nach dem Fortgang des Textes Petrus vollständig versagen und damit seine „Probe“ nicht bestehen. Jesus tritt für ihn und die anderen Jünger als Anwalt der Gnade vor Gott ein. Dessen Treue im Glauben ist eine Gabe und bedarf nicht einer menschlichen religiösen Leistung. In diesem Glaubensverständnis wird Petrus zu dem, der die Verantwortung und Führung auch für seine gefährdeten Mitchristen übernehmen kann.
Jesus gibt dem Jünger Simon den Beinamen Kephas. Aus diesem Kephas wird der griechische Name Petrus, dessen Übersetzung Petrus (Stein, Fels) zu einer Funktionsbezeichnung des Jüngers Simon wird. Der im Neuen Testament verwendete Doppelname muss also als Simon der Petrus (Fels) gelesen werden.
Nach den neutestamentlichen Schriften war Simon Petrus wie sein Bruder Andreas von Beruf Fischer. Wir erfahren, dass er verheiratet war und in dem kleinen Ort Kapernaum am See Genezareth wohnte. Nach dem Johannesevangelium war er durch sein Bruder mit der Gruppe Johannes des Täufers in Verbindung gekommen. Andreas und Simon werden dann die ersten Jünger Jesu. Das Markusevangelium berichtet in seinem dritten Kapitel, dass er bei der Konstitution des zwölfköpfigen Jüngerkreises den Beinamen „Kephas“ (Edelstein) erhält. Im gleichen Evangelium formuliert er das „Messiasbekenntnis“ und in dem dramatischen Geschehen des Leidens und Sterbens Jesu wird er zum Verleugner. Nach den Frauen ist Simon Petrus der erste Zeuge für die Auferstehung Jesu aus dem Grab. In der nach Ostern sich bildenden ersten christlichen Gemeinde in Jerusalem wird er deren Leiter und nach den ersten zwölf Kapiteln der Apostelgeschichte zum Begründer einer Missionstätigkeit, die sich besonders den Juden zuwendet. Bei dem im Jahre 49 nach Christus in Jerusalem stattfindenden Apostelkonzil (Apostelgeschichte Kapitel 15) vermittelt er zwischen den Positionen der Jerusalemer Gemeinde und der Gruppe um Paulus, die in ihrer Missionstätigkeit unter den Nichtjuden (Heiden) antijüdische Vorstellungen vertritt. Petrus hat ebenso wie Paulus und andere Jünger/Apostel Jesu Missionsreisen unternommen. Aller Wahrscheinlichkeit nach erlitt Simon Petrus im Jahre 67 nach Christus unter dem römischen Kaiser Nero in Rom den Märtyrertod, d. h. er wurde wegen seines christlichen Glaubens mit dem Schwert hingerichtet.
Das erste Jahrhundert der christlichen Kirche ist wesentlich von drei Personen des Jüngerkreises Jesu geprägt worden. Die besondere Heraushebung des Lieblingsjüngers Johannes wird in der durch diese geprägte „Theologenschule“ sichtbar, aus deren Bereich heraus das Johannesevangelium und die Johannesbriefe entstehen.
Durch Paulus wird die Missionstheologie geprägt, durch die der christliche Glaube sich sehr schnell in dem damaligen römischen Weltreich ausbreitet und schon zu Beginn des vierten nachchristlichen Jahrhunderts zur Staatsreligion wird.
Die gesamtkirchliche Autorität des Petrus dürfte aber schon damals unumstritten gewesen sein. Sie ist begründet durch die von Jesus geschehene Hervorhebung im Jüngerkreis, so dass sich Simon Petrus als Wortführer dieser Gruppe verstand.
Diese Autorität des Petrus wird schon in den neutestamentlichen Schriften immer mehr ausgebaut und erfährt dann in der Weiterentwicklung der christlichen Gemeinden zu einer übergreifenden Kirchenorganisation eine herausragende Bedeutung, bis dann in er Verschmelzung von römischem Kaiseramt mit der gewachsenen Petrustradition sich das römische Papsttum entwickelt.
Predigttext zum Sonntag Estomihi (18. 2.) aus dem Evangelium des Lukas, Kapitel 18,
die Verse 31 – 43
Er nahm aber zu sich die Zwölf und sprach zu ihnen:
Seht, wir gehen hinauf nach Jerusalem, und es wird alles vollendet werden, was geschrieben ist durch die Propheten von dem Menschensohn. Denn er wird überantwortet werden den Heiden, und er wird verspottet und misshandelt und angespien werden, und sie werden ihn geißeln und töten, und am dritten Tag wird er auferstehen.
Sie aber begriffen nichts davon, und der Sinn der Rede war ihnen verborgen, und sie verstanden nicht, was damit gesagt war.
Es begab sich aber, als er in die Nähe von Jericho kam, dass ein Blinder am Wege saß und bettelte. Als er aber die Menge hörte, die vorbeiging, forschte er, was das wäre.
Da berichteten sie ihm, Jesus von Nazareth gehe vorbei.
Und er rief: Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich meiner!
Die aber vornean gingen, fuhren ihn an, er solle schweigen. Er aber schrie noch viel mehr:
Du Sohn Davids, erbarme dich meiner!
Jesus aber blieb stehen und ließ ihn zu sich führen. Als er aber näher kam, fragte er ihn:
Was willst du, dass ich für dich tun soll? Er sprach: Herr, dass ich sehen kann.
Und Jesus sprach zu ihm: Sei sehend! Dein Glaube hat dir geholfen.
Und sogleich wurde er sehend und folgte ihm nach und pries Gott.
Und alles Volk, das es sah, lobte Gott.
Der lateinische Namen des Sonntags „Esto mihi“ gibt eine gute Gelegenheit, auf den Eingangsteil des lutherischen Hauptgottesdienstes einzugehen. Für jeden Sonntag gibt es einen Psalm, der nach dem Orgelvorspiel im Wechsel mit der Gemeinde gesungen oder gesprochen werden kann. (Der jeweilige Psalm wird nach den beiden Lesungen unter der Nummer 954 und der Zusatznummer des jeweiligen Sonntages – also 954.22 – angegeben.
Die Mehrzahl der Psalmen sind unter der Nummer 702 im Gesangbuch abgedruckt.) Beim Singen des Psalmes – an diesem Sonntag der Psalm 31 – wird ein Rahmentext (lateinisch: Antiphon) gesungen. Die ersten beiden Worte dieser Antiphon „Sei mir (Esto mihi) ein starker Fels“ haben dem Sonntag den Namen gegeben. So sind auch die Namen der kommenden Passionssonntage bis einschließlich „Judika“ zu erklären.
Mit dem diesen Sonntag folgenden Aschermittwoch wird die Vorfastenzeit abgeschlossen. Die Karnevalszeit kommt mit dem Rosenmontag zu ihrem Höhepunkt. Auf die Bedeutung der beginnenden Fasten- oder Passionszeit gehe ich bei der Vorstellung des Predigttextes des kommenden Sonntages ein.
In dem Predigtext sind zwei Abschnitte aus dem Lukasevangelium zusammengefasst, die in den Evangelien des Markus und Matthäus anders eingeordnet sind. Mit diesem so geordneten Predigttext tritt die inhaltliche Aussage in den Vordergrund, dass das Leiden, Sterben und die Auferstehung Jesu zum Lob Gottes führen. (In der ersten, der Epistellesung, wird der Texte des „Hohen Liedes“ aus dem Korintherbrief gelesen.)
Das um 70 nach Christus entstandene Lukasevangelium bildet mit der Apostelgeschichte eine Einheit. Der Schreiber dieses ersten christlichen „Geschichtswerkes“ will zeigen, dass die frohe Botschaft des Jesus, des Christus, ihren erfolgreichen Weg von dem kleinen Ort Bethlehem in die Hauptstadt der Welt – Rom - genommen hat.
Beide Werke sind einem Theophilus gewidmet. In dem Vorwort des ersten Kapitels des Evangeliums gibt der Verfasser über die Absicht seines Werkes Auskunft. Er will Theophilus und allen anderen Lesern das apostolische Christuszeugnis vollständig und endgültig aufschreiben. Dazu hat er nicht nur die mündlichen Zeugnisse der Apostel und die Werke seiner Vorgänger (Markus u .a.) einfach übernommen, sondern diese sorgfältig geprüft und der „Reihe nach“, also nach einer inhaltlichen Ordnung aufgeschrieben.
Lukas will die Geschichte Jesu als einen Abschnitt der Heilsgeschichte verstanden wissen.
Stand am Anfang die Zeit des Volkes Israel und seiner Propheten, so ist die Zeit Jesu und der Kirche die Zeit der Erfüllung.
Unser Text beginnt mit der dritten Leidensankündigung. Mit dieser beginnt das letzte Stück des Weges nach Jerusalem, dem Ort des Leidens, Sterbens und der Auferstehung Jesu.
Gegenüber den vorhergehenden Leidensankündigungen werden nun der Ablauf der Folterungen und die Tötung durch Nichtjuden genannt. Zu den Besonderheiten des Lukasevangeliums gehört der Hinweis darauf, dass Jesus leidend und sterbend die Worte der Propheten erfüllen werde und die ausdrückliche Benennung des mangelnden Verständnisses der Jünger.
An dieser Stelle ist auf ein grundlegendes Problem der neutestamentlichen Schriften und damit auch der Evangelien einzugehen. Das Lukasevangelium ist frühestens 70 nach Christus geschrieben. Die Ereignisse der Zeit des Lebens Jesu liegen eine Generation zurück. Eine intensive Missionstätigkeit hat eingesetzt, in deren Zentrum die Christusgeschichte steht, der „sichere Grund der Lehre“, wie es Lukas in seinem Vorwort Kapitel 1, 1-4 schreibt. Dieser ist nach Lukas 24, 46: „dass Christus leiden wird und auferstehen von den Toten am dritten Tage; und dass gepredigt wird in seinem Namen Buße zur Vergebung der Sünden unter den Völkern“.
So beginnt mit dem Weg nach Jerusalem die Frage nach der Bedeutung Jesu als des von Gott gesandten Messias, den die Jünger erst in seiner wahren Bedeutung als Auferstandenen erkennen. Dies so inhaltlich gestaltete Evangelium will das dem Leser und Zuhörer deutlich machen und ihn damit zum Glauben führen.
Der blinde Bettler spricht also in unserem Textzusammenhang ein Christusbekenntnis aus, wenn er Jesus als „den Sohn Davids“ anruft. Die Christusfrage wird die Tage Jesu in Jerusalem bis zuletzt bestimmen. Die im jüdischen Volk verbreiteten politisch-theologischen Heilserwartungen richteten sich auch auf eine Erneuerung des davidischen Königtums.
Die Anrede des Blinden ist also eine Anfrage an Jesus, ob er sich zu seiner „Messianität“ bekennen will. Jesus bejaht dies, indem er den Blinden heilt. Das Wunder dient somit zur Enthüllung seines besonderen Amtes, nicht der Verherrlichung seiner Person. So steht am Ende des Textes nicht das Lob Jesu, sondern das Gottes. Mit seinem Leben, Sterben und Auferstehen sollen die Macht und die Herrlichkeit Gottes unter den Menschen erfahrbar werden.
